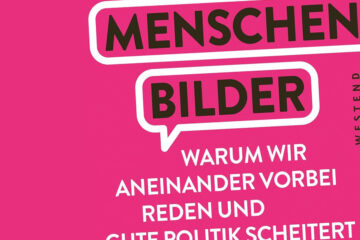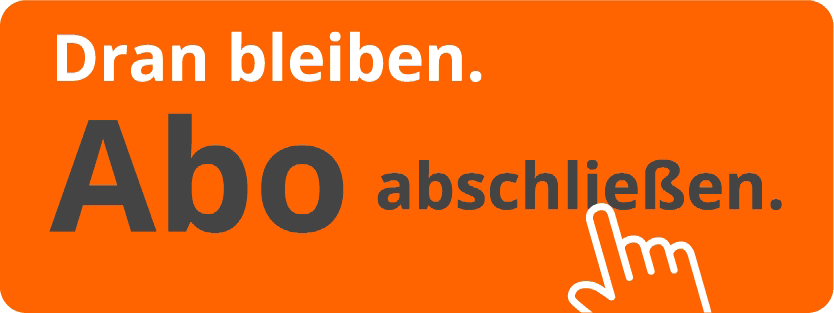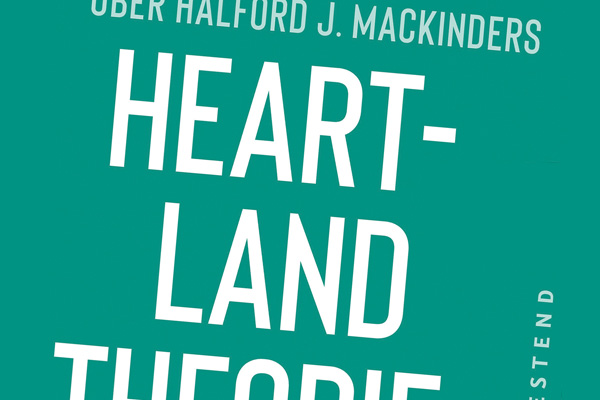
Ein geostrategisches Konzept und seine Folgen
17. September 2025
Die „Heartland-Theorie“ wurde vom britischen Geografen Halford J. Mackinder konzipiert und 1904 veröffentlicht. Sie beleuchtet die Bedeutungen von Geografie, Technik, Wirtschaft, Rohstoffen, Bevölkerung sowie militärischer Landmacht und Seemacht. In den USA wurde sie weiterentwickelt – mit Konsequenzen für Europa.
von Günther Hartmann
Halford J. Mackinder befürchtete einen Zusammenbruch des britischen Weltreichs und warnte vor dem naiven Glauben an einen dauerhaften Machterhalt durch dessen überlegene Kriegsmarine. Denn die Motorisierung und das damit einhergehende Straßen- und Eisenbahnnetz stärken die Landmächte – und schwächen die Seemacht Großbritannien. Mit dem Begriff „Heartland“ – deutsch: „Herzland“ – meinte Mackinder das Zentrum Eurasiens. Er prophezeite, ein mächtiger Staat, dem die Errungenschaften moderner Technik zur Verfügung stünden, könnte die Herrschaft über diese kontinentale Landmasse und in der Folge die Weltherrschaft erringen.
Mit einem berühmt gewordenen Zitat brachte Mackinder seine Befürchtung auf den Punkt: „Wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel. Wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt.“ Unter „Weltinsel“ verstand er Eurasien plus Afrika. Deren Rohstoff- und Bevölkerungsressourcen würden die Beherrschung der kontinentalen „Randländer“ und schließlich auch des amerikanischen und australischen Kontinents ermöglichen.
Mackinders Analyse beeinflusst US-amerikanische Geostrategen bis heute. „Das Hauptinteresse der USA, für das wir immer wieder Krieg geführt haben – im Ersten und Zweiten Weltkrieg und auch im Kalten Krieg –, waren die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland. Weil vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse besteht darin, sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt“, schreibt z. B. der Sicherheitsexperte George Friedman. Und der Historiker Alfred W. McCoy interpretiert den zunehmenden Konflikt zwischen den USA und China als letzte Runde in einem jahrhundertelangen Kampf um die Kontrolle der eurasischen Landmasse.
Die deutsche Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot wurde vom Westend-Verlag gebeten, in einem Vorwort zur Neuauflage der „Heartland-Theorie“ der Frage nachzugehen, wie aktuell diese ist, welchen Einfluss sie auf die gegenwärtigen weltpolitischen Geschehnisse hat – und welche Rolle Europa dabei spielt bzw. spielen könnte. Heraus kam mehr als ein Vorwort.
USA: Außenpolitik als Schachspiel
Guérot schildert den Einfluss Mackinders auf das Selbstverständnis der US-amerikanischen Außenpolitik. Zbigniew Brzezinski hebt sie dabei hervor. Er war unter mehreren US-Regierungen als Politikberater tätig, frischte Mackinders Theorie auf und veröffentlichte seine Neuinterpretation 1997 unter dem Titel „The Grand Chessboard“ – übersetzt: „Das große Schachspiel“. In Deutschland erschien das Buch unter dem Titel „Die einzige Weltmacht“. Brzezinski betont darin den Rohstoff- und Bevölkerungsreichtum Eurasiens und resümiert: „Als Ganzes genommen stellt das Machtpotenzial dieses Kontinents das der USA weit in den Schatten. Zum Glück ist Eurasien zu groß, um eine politische Einheit zu bilden.“
Doch es geht nicht nur um die Angst, dass die USA ihre Vormachtstellung einbüßen könnten. Brzezinskis Buch ist auch aus einem Gefühl der Überlegenheit geschrieben, in einem herablassenden und abwertenden Ton, „ganz so, als hätten die Staaten Eurasiens kein Recht auf ihren Rohstoff-Reichtum, kein Recht auf ihre jahrtausendelange Geschichte und Kultur“, stellt Guérot fest. „Russland ist kein Partner, sondern offensichtlich Verfügungsmasse für die USA. In diesem Punkt treffen sich Mackinder und Brzezinski.“
Brzezinski war kein Außenseiter, kein Spinner, sondern ein hochgeschätzter und einflussreicher Regierungsberater. „Brzezinski, dessen Buch gleichsam die Bibel der amerikanischen Neocons wurde, hat die Grundlage für die trotz gegenläufiger Zusage seit 1994 ständig betriebene Ausdehnung der NATO nach Osten betrieben und diese Strategie in Europa eingepflockt“, betont Guérot. „Brzezinskis Buch nimmt ziemlich genau die heutigen Ereignisse in der Ukraine vorweg und weist den russisch-ukrainischen Krieg de facto als amerikanischen Stellvertreterkrieg aus.“
Mit ihrem berühmten „Fuck the EU!“ brachte 2004 Victoria Nuland, damals Sprecherin des US-Außenministeriums und Ehefrau des einflussreichen Politikberaters Robert Kagan, treffend zum Ausdruck, was die USA von Europa halten. Deshalb kann es, findet Guérot, für Europa nur eine sinnvolle Strategie geben: Emanzipation!
Europa: Miteinander statt Gegeneinander
Emanzipation? Leichter gesagt als getan. Denn dafür bräuchte es ein neues Selbstbewusstsein und ein neues Selbstverständnis. Doch woher soll das kommen? „Allein eine Rückbesinnung auf seine Geschichte kann Europa retten und seine Emanzipation befördern“, meint Guérot. Für sie zeichnet sich Europa durch eine über Jahrhunderte hochentwickelte „Kunst der Diplomatie“ aus. Sie erinnert an die zahlreichen Kriege, die durch Friedensverhandlungen und Friedensschlüsse beendet wurden. Oder im Vorfeld verhindert wurden.
Mit „Europa ist Diplomatie“, beschreibt Guérot das von ihr favorisierte Selbstverständnis. „Europa möchte keinen Schlüssel zur Weltherrschaft. Es möchte keine Dominanz. Europa ist der einzige geografische Raum der Welt, der keine starre Zentralmacht ausgebildet hat. Europa hat ein permanentes Gleichgewicht der Mächte ausgeklügelt. Europa ist strukturell anti-imperial.“
Guérot empfiehlt als wohltuenden Kontrast zu Mackinders und Brzezinskis Denken das 1990 erschienene Buch „Europa und seine Nationen“ des polnischen Historikers Krzysztof Pomian. Er beschreibt Europa als eine „seit dem 12. Jahrhundert auf Einigung hinstrebende Realität“, als „fluides Hin und Her von Völkern, Ethnien, Kulturen und Religionen“. Zwar wimmelte es in Europa von Grenzen, doch diese trennten nicht, weil sie von einem komplexen Beziehungsgeflecht überlagert wurden.
Eine lebendige Vielfalt an Traditionen und Kulturen im friedlichen Nebeneinander und kreativen Miteinander – das, was Pomian als Europas Charakter und als Ideal beschreibt, kommt in den Theorien von Mackinder und Brzezinski nicht vor. Ihr Denken ist für Guérot noch vom Denken des 18. und 19. Jahrhunderts geprägt, von der scharfen Logik Isaak Newtons, der die physikalische Wirklichkeit mit einfachen Prinzipien und Formeln erklärte. Ähnlich gingen danach auch Adam Smith beim Erklären der Wirtschaft und Charles Darwin beim Erklären der Evolution vor.
Die ebenfalls wissenschaftlich anmutende Logik von Mackinder und Brzezinski, vermutet Guérot, dient aber vornehmlich dazu, ihr wahres Motiv zu verbergen: „Es geht nur scheinbar um Küsten und Meerengen, sondern eigentlich um das Gefühl der Überlegenheit, das mit der Geografie nur rationalisiert wird. Gerade in dieser Hinsicht überbietet das Buch von Brzezinski noch die ursprüngliche Mackinder-Theorie.“
Das sollte Europa endlich erkennen, die richtigen Schlüsse daraus ziehen und seine eigene Identität wiederentdecken, fordert Guérot: „Die Verbindung mit den eigenen, mit den kulturellen Wurzeln ist die Vorbedingung für eine multipolare Welt: Ich kann den anderen nur erkennen, wenn ich selbst weiß, wer ich bin. Europa weiß das zurzeit nicht mehr, da es atlantisiert und verwestlicht wurde und sich selbst derzeit nur noch durch diese Brille lesen kann.“
Das ist eine Absage an die Ökonomisierung der Welt. Und eine Absage an ein Denken, das die Welt als ein Spiel betrachtet, in dem es nur um die Frage „Siegen oder verlieren?“ geht. Soll Europa dieses Spiel mitspielen oder soll es ein anderes Spiel etablieren? Guérot stellt dem Wirtschaftsliberalismus und -imperialismus etwas entgegen: „Europas Juwel in der Ideengeschichte ist der Begriff der Republik, der res publica, des öffentlichen Guten und des gemeinen Wohls.“
 Ulrike Guérot
Ulrike Guérot
Über Halford J. Mackinders Heartland-Theorie
Der geografische Drehpunkt der Geschichte
Westend, Dezember 2024
128 Seiten, 16.00 Euro
978-3-86489-496-1
Onlinetipps
Über Ulrike Guérots
ZeitenWenden
ÖkologiePolitik, 15.09.2025
www.t1p.de/ofpws
Über Zbigniew Brzezinskis
Die einzige Weltmacht
ÖkologiePolitik, 16.09.2025
www.t1p.de/dfybv
Interview mit Ulrike Guérot
„Europa braucht ein klares Ziel“
ÖkologiePolitik, 07.03.2019
www.t1p.de/mr5dv