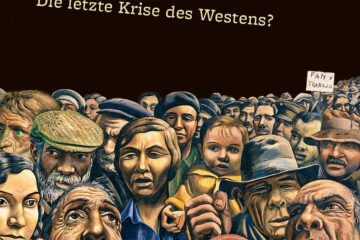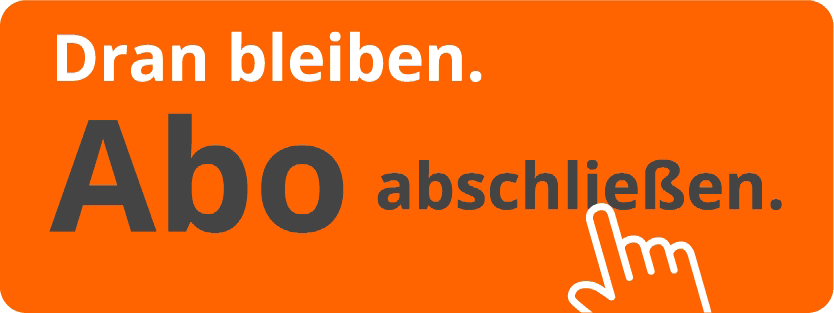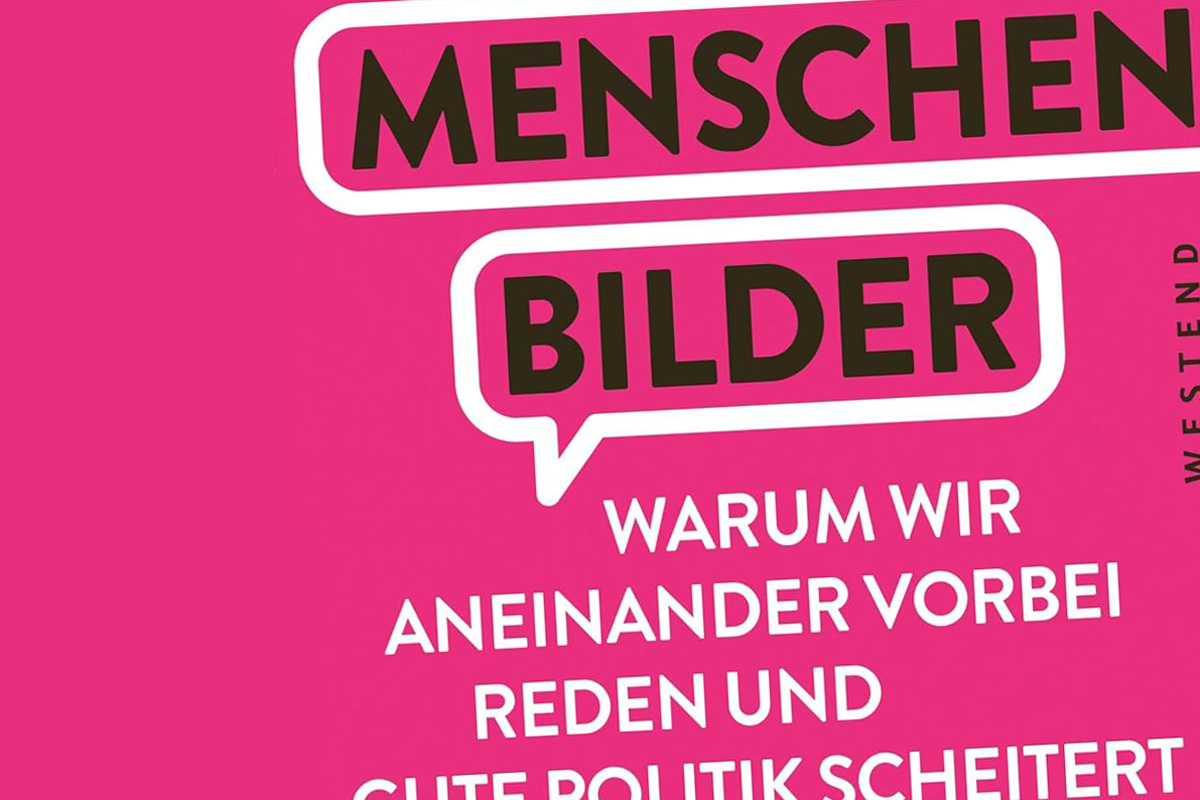
Wie Menschenbilder polarisieren
24. November 2025
In unserer Gesellschaft finden keine wirklichen Gespräche mehr statt, kein Gedankenaustausch, kein Versuch, den anderen zu verstehen. Eine pragmatische, gemeinwohlorientierte Politik ist da schwierig. Psychologie-Professor Bernhard Hommel sieht die Ursache in konträren Menschenbildern und erläutert diese These in einem lesenswerten Buch.
von Günther Hartmann
Menschenbilder sind nie Gegenstand der politischen Diskussionen, bestimmen aber die politischen Positionen und Konzepte maßgeblich. Sie wirken im Hintergrund, bleiben unausgesprochen, werden deshalb nicht kritisch beleuchtet und hinterfragt. Hommel will das mit seinem Buch ändern. Denn Menschenbilder sind „in der Regel nicht das Ergebnis ausgiebiger vernünftiger Erwägungen, sondern das unterbewusste Produkt einer komplexen Mixtur aus genetischen Prädispositionen und frühkindlicher Prägungen“.
Aus den Menschenbildern leiten sich die Einstellungen zu vielen Aspekten des Lebens ab – und auch zur Politik. „Meinungen tauchen nicht aus dem Nichts auf und basieren in der Regel nicht auf tiefgreifenden Überlegungen, sondern sie werden von dem Menschenbild suggeriert, das diese Personen haben“, betont Hommel. „Es repräsentiert die Grundannahmen, die man nicht diskutieren möchte, weil man sie schlichtweg als gegeben ansieht.“
Zwei konträre Menschenbilder
Hommel konzentriert sich in seinem Buch auf zwei konträre Menschenbilder: auf das agentative und auf das reflektorische Menschenbild. Das agentative Menschenbild betrachtet Menschen als freie, vernunftbegabte Individuen, die sich informieren, Argumente abwägen, auf dieser Basis ihre Meinung bilden und Entscheidungen fällen. Auf diesem Menschenbild basiert unsere Demokratie. Das reflektorische Menschenbild dagegen sieht Menschen vornehmlich als Ergebnisse gesellschaftlicher Verhältnisse und als Teil gesellschaftlicher Gruppen. Auf diesem Menschenbild basiert der klassische Marxismus, aber auch die heutige Identitätspolitik.
Für die Anhänger des agentativen Menschenbilds hat der Staat die Aufgabe, ausreichend Informationen zur Verfügung zu stellen, damit seine Bürger vernünftige Entscheidungen fällen können. Fallen Entscheidungen unvernünftig aus, so ist das auf einen Mangel an Information zurückzuführen und lässt sich durch ein Mehr an Informationen beheben. Für die Anhänger des agentativen Menschenbilds ist der wohl wichtigste Wert die Freiheit. Ihr bevorzugtes Wirtschaftssystem ist die freie Marktwirtschaft.
Die Anhänger des reflektorischen Menschenbilds interessieren sich dagegen vornehmlich für gesellschaftliche Gruppen und Machtgefälle. Die Bürger betrachten sie eher als unmündig und greifen deshalb gerne zu restriktiven und erzieherischen Maßnahmen – so wie z. B. die Anhänger der linksidentitären Bewegung zu rigiden Sprachregelungen. Für die Anhänger des reflektorischen Menschenbilds ist der wohl wichtigste Wert die Gleichheit. Ihr bevorzugtes Wirtschaftssystem ist die Planwirtschaft.
Die fassettenreichen Konsequenzen, die sich aus den beiden Menschenbildern für verschiedene gesellschaftliche Fragen und Herausforderungen ergeben, beschreibt Hommels in mehreren Kapiteln ausführlich. Unter Gerechtigkeit z. B. verstehen Anhänger des agentativen Menschenbilds vor allem Chancengleichheit, die Anhänger des reflektorischen Menschenbilds dagegen Ergebnisgleichheit. Das führt dann zu völlig unterschiedlichen Lösungsansätzen.
Das Dilemma der Menschenbilder
In der Verfolgung von Konzepten, die sich aus einem der beiden konträren Menschen ableiten, sieht Hommel große Probleme: Zum einen wird eine Bevölkerungsgruppe gegenüber der anderen vernachlässigt und in ihren Möglichkeiten behindert. Zum anderen werden große Teile der Bevölkerung mit subtilen Methoden nach dem favorisierten Menschenbild geformt.
Dass wir zu einfachen Menschen- und Weltbildern neigen, liegt daran, dass sie uns entlasten. Sie ermöglichen, auf Herausforderungen schnell reagieren zu können, ohne dabei allzu sehr gestresst oder gar überfordert zu werden. Sie machen das Leben entspannter und angenehmer. Aber je geschlossener die Menschen- und Weltbilder sind, desto schwieriger wird die Kommunikation. Die Logik des einen Systems lässt sich nicht auf die Logik des anderen Systems abbilden.
Das lässt sich fast täglich in politischen Talkshows beobachten, schreibt Hommel: „Die Gesprächsrunden erwecken den Anschein, dass es um das Ringen um gemeinsame Lösungen geht. Tatsächlich werden aber nur Auszüge aus dem eigenen Weltbild vorgebracht. Also Meinungssätze, die ohne allgemeingültige Begründung nur im eigenen Weltbild Sinn machen. Ohne jede Ambition und ohne jeden Versuch, diesen Sätzen im jeweils anderen System Sinn zu verleihen.“
Wie das Dilemma zu überwinden ist
Konkrete Lösungsansätze deutet Hommel nur an. Als wissenschaftlich arbeitender Psychologe will er allgemeingültige Ratschläge geben. Einer lautet: die eigenen Überzeugungen immer wieder an der Realität prüfen. „Das ist es, was wir von der Wissenschaft lernen können. Wissenschaft ist deswegen erfolgreich, weil sie ihre eigenen Voraussetzungen immer wieder systematisch hinterfragt. Politik könnte das auch tun.“ Ein weiterer Ratschlag: von Politikern fordern, ihre Ziele möglichst konkret zu formulieren und die Lösungskonzepte zur Zielerreichung möglichst konkret zu beschreiben. Denn je konkreter diese definiert, desto besser lassen sich ihre Realitätsnähe und Wirksamkeit beurteilen.
Eine allgemeine Grundvoraussetzung für eine stärker am Gemeinwohl orientierte Politik: die Einsicht, dass viele Ziele und Lösungsansätze auf einer subjektiven Werteabwägung und -gewichtung basieren und nicht auf Wissenschaft. „Wenn ich verstehe, dass andere Gewichtungen nicht weniger plausibel sind, sollte ich in der Lage sein, die Vehemenz meiner Ablehnung und Empörung etwas mehr zu zügeln“, schreibt Hommel und empfiehlt dialektisches Denken zum Einüben von mehr Gelassenheit und Toleranz.
Konkreter wird Hommel in seinem Buch nicht, im Interview mit dem Online-Magazin „Overton“ dann aber doch: „Ein wichtiger Schritt wäre die Stärkung der bürgerlichen und kommunalen Mitbestimmung, also einer Bottom-up-Route, die der momentan vorherrschenden zentralen Top-down-Regulierung entgegenwirkt. Weil die kommunale Ebene die einzige ist, wo die Politik noch die wirklichen Probleme der Leute im Auge hat und haben muss, und wo man in der Regel ganz gut trainiert ist, über Ideologien und Parteigrenzen hinweg praktische Lösungen zu finden.“
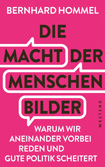 Bernhard Hommel
Bernhard Hommel
Die Macht der Menschenbilder
Warum wir aneinander vorbeireden und gute Politik scheitert
Westend, Oktober 2025
144 Seiten, 20.00 Euro
978-3-98791-316-7
Onlinetipps
Bernhard Hommel
Selbstermächtigung und Minderheitenschutz
Overton, 01.11.2025
www.t1p.de/9dbss
Interview mit Bernhard Hommel
„Ein irgendwie besseres Menschenbild gibt es nicht“
Overton, 23.10.2025
www.t1p.de/wv9gk
Interview mit Bernhard Hommel
„Nun mal im Ernst …“
ÖkologiePolitik, 23.07.2025
www.t1p.de/kejcx
Über Bernhard Hommels
Wir triggern uns zu Tode
ÖkologiePolitik, 24.02.2025
www.t1p.de/apvu2
Bernhard Hommel
Psychogramm einer neurotischen Gesellschaft
Overton, 26.08.2024
www.t1p.de/q20dd
Über Bernhard Hommels
Gut gemeint ist nicht gerecht
ÖkologiePolitik, 23.07.2024
www.t1p.de/z1457