
Raum‚ Zeit und Stress
9. April 2020
Unsere Verkehrsprobleme sind auch das Ergebnis falscher Leitbilder in Stadt- und Raumplanung. Diese sind durch ganzheitliche Konzepte zu ersetzen, welche sowohl die ökologischen Notwendigkeiten als auch die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen. Ein Berliner Forschungsprojekt liefert dazu wichtige Erkenntnisse. Und ein kolumbianischer Bürgermeister setzt Zeichen.
von Günther Hartmann
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts euphorisierte die aufkommende Automobilität viele Architekten und inspirierte sie zu kühnen Zukunftsvisionen. In den USA entwickelte Frank Lloyd Wright seine Idee einer „Broadacre City“: eine suburbane, dezentrale Landschaft, in der die Einwohner jeweils 1 Acre (ca. 4.000 m2) Land besitzen und durch ein Straßennetz miteinander verbunden sind. In Frankreich entwarf Le Corbusier sein Ideal einer „Ville Contemporaire“: monofunktionale Stadtteile, getrennt durch großzügige Parkanlagen, verbunden mit breiten Straßen.
Le Corbusier beeinflusste maßgeblich die europäische Denkfabrik „Congrès Internationaux d’Architecture Moderne“ (CIAM), die 1933 bei ihrer vierten Zusammenkunft die legendäre „Charta von Athen“ beschloss: ein radikales Manifest, das sich entschieden von der klassischen europäischen Stadt abwandte und die aufgelockerte, durchgrünte und autogerechte Stadt propagierte. Dieses Leitbild entfaltete nach dem Zweiten Weltkrieg seine Wirkung, beeinflusste die Planungspraxis und floss auch in die Baugesetzgebung ein. Die Folgen waren eine Auflösung der klassischen Stadtstruktur und eine Zersiedlung der Landschaft.
1964 wurde diese Entwicklung vom Wiener Architekten Hans Hollein mit einer berühmt gewordenen Fotomontage, die heute im New Yorker Museum of Modern Art hängt, scharf kritisiert: ein Flugzeugträger in einer weiten, unbebauten Landschaft. Das war sein provokantes Symbol für eine Rückbesinnung auf die klar begrenzte, hochverdichtete, multifunktionale und komplexe Stadt der Vergangenheit.
Ökologischer Stadtumbau – in welche Richtung?
Nichts hat im 20. Jahrhundert die Raumstrukturen so grundlegend verändert wie das Auto. Zum einen ermöglichte es eine Vermischung von Stadt und Landschaft, zum anderen eine Entmischung der Funktionen. Dies raubte der Stadt ihre wohl größte Stärke: Nähe. Aus ökonomischer Perspektive senkt Nähe die Transportkosten für Menschen und Güter. Aus ökologischer Perspektive senkt sie den Verbrauch an Bodenfläche, Rohstoffen und Energie.
Um bei der Frage, in welche Richtung eine ökologische Stadtentwicklung eigentlich gehen soll, eine grobe Orientierung zu erhalten, ist es hilfreich, zunächst die Extreme zu betrachten. Die Ausgangsfrage lautet: Was ist ökologisch sinnvoller – eine lockere Bebauung mit viel Grün zwischen den Gebäuden? Oder eine dichte Bebauung mit wenig Grün zwischen den Gebäuden, aber umso mehr Grün außerhalb? Die Antwort ist gar nicht so eindeutig. Sie hängt von der Perspektive ab, davon, ob wir eine eigennutzorientierte oder eine gemeinwohlorientierte Ökologie wollen.
Gemeinwohlorientiert? Auch das ist ein unklarer Begriff, der variiert – je nachdem, ob wir unseren Betrachtungshorizont an der Ortsgrenze enden lassen oder weit darüber hinausblicken. Wenn wir Letzteres tun, dann lautet analog zu John F. Kennedys „Frage nicht, was Amerika für dich tun kann, sondern frage, was du für Amerika tun kannst!“ das Motto: „Frage nicht, wie deine Stadt für dich angenehmer werden kann, sondern was deine Stadt tun kann, damit dein ökologischer Fußabdruck sinkt!“
Eine ökologische Transformation muss den strukturbedingten Verbrauch an Bodenfläche, Rohstoffen und Energie senken. Und den strukturbedingten Müll – den stofflichen und vor allem den gasförmigen Müll, nämlich CO2 und Feinstaub. Eine ökologische Transformation muss zu etwas Verallgemeinerbarem führen. „Handle so“, sagte Immanuel Kant, „dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip zur allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“
Auto ermöglicht gießkannenartige Zersiedelung
In grüner Umgebung zu wohnen, ist schön, umweltschonend ist es nicht. Denn es treibt den persönlichen ökologischen Fußabdruck in die Höhe. Je geringer die Geschosszahl eines Gebäudes, desto höher der Pro-Kopf-Verbrauch an Bodenfläche seiner Bewohner. Und je geringer die Einwohnerdichte, desto mehr Wegstrecken werden mit einem Auto zurückgelegt. Und Autos wiederum brauchen viel Bodenfläche für Straßen und Parkplätze sowie viel Rohstoffe und Energie.
Selbstverständlich ist innerhalb von dicht bebauten Gebieten kein Lebensraum mehr für „richtige“ Natur mit heimischen Wildtieren wie Rehen oder Wildschweinen, außerhalb dafür umso mehr. Zumindest theoretisch. Praktisch leider oft nicht. Denn das Umland ist meist auch besiedelt. Denn die Siedlungsentwicklung erfolgte fast immer gießkannenartig in einer Raumstruktur, die aus der agrarwirtschaftlichen Epoche stammt. Das Wachstum erfolgte „organisch“.
Jeder Ort – egal wie groß – wies Neubaugebiete aus und wuchs. Manche Orte weniger, manche Orte mehr. Und so ist die Raumstruktur heute geprägt von zu vielen zu kleinen und zu wenig dichten Siedlungsflächen. Obwohl seit den 1960er-Jahren bekannt war, dass ein differenziertes Arbeitsplatzangebot sowie eine gute Versorgung mit Schulen, Ärzten, Einkaufs-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen erst bei Mittelstädten möglich ist, also bei über 20.000 Einwohnern. Doch durch das Auto war es möglich, die 20.000 Einwohner auf einem weiten Gebiet zu verteilen. Dies machte wiederum abhängig vom Auto.
Arbeitsplatzüberangebot erzeugt Wohnungsnot
Geschah die Zersiedlung früher vor allem durch den Wunsch nach einem „Häuschen im Grünen“, geschieht sie heute zunehmend unfreiwillig. Denn in prosperierenden Städten sind die Kosten fürs Wohnen so gestiegen, dass es sich viele Einwohner nicht mehr leisten können. Am extremsten ist die Situation in München: Hier stiegen die Preise für Eigentumswohnungen in den letzten 10 Jahren auf das Doppelte und die Mieten um die Hälfte.
Die Kostenexplosion in München ist die logische Konsequenz der Stadtentwicklungspolitik. Ihr Ehrgeiz war, im großen Stil umsatzstarke Unternehmen vor allem aus dem Hightech-Bereich anzusiedeln, um hohe Gewerbesteuereinnahmen zu erzielen. Das gelang – ohne dass parallel dazu in gleichem Maße Wohnraum errichtet wurde. So entstand eine fatale Schieflage: ein Überangebot an lukrativen Arbeitsplätzen, was zum massenhaften Zuzug hochqualifizierter und hochbezahlter Arbeitnehmer führte – und den Wohnraum dramatisch verknappte und verteuerte. Das Ergebnis ist eine Hypergentrifizierung: Die obere Mittelschicht verdrängt die untere Mittelschicht aus der Stadt ins Umland.
Die Verdrängten arbeiten aber in der Stadt, denn hier sind ja die Arbeitsplätze. So fahren heute täglich 390.000 Pendler nach München und verstopfen die Straßen. Zum Vergleich: Ins zweieinhalbmal so große Berlin fahren täglich nur 315.000 Pendler. München ist damit „deutsche Pendler-Hauptstadt“ – und in der Konsequenz auch „deutsche Stau-Hauptstadt“. Im Stau geht viel Zeit verloren: 87 Stunden pro Jahr und Autofahrer.
Immer mehr Pendler, immer weitere Strecken
Pendler gibt es aber nicht nur in Großstädten, sondern überall. Und ihre Zahl steigt in ganz Deutschland kontinuierlich an: von 14,9 Mio. im Jahr 2000 auf 19,3 Mio. im Jahr 2018. Und auch die durchschnittliche Länge der Arbeitswege nimmt zu: von 14,8 Kilometer im Jahr 2000 auf 16,9 Kilometer im Jahr 2018. In dünn besiedelten Regionen liegt die durchschnittliche Fahrstrecke gar bei 30 Kilometern.
Immer mehr Pendler mit immer längeren Fahrstrecken – das rührt daher, weil heute quasi alle Regionen sogenannte „urbane Regionen“ sind. Mit „urban“ ist hier gemeint, dass die Bevölkerung überwiegend Berufen nachgeht, die nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben – auch wenn die Raumstruktur aus der agrarwirtschaftlichen Epoche stammt. Das Resultat ist übermäßiger Autoverkehr. Denn selbst wenn ein Ort neue Unternehmen ansiedelt, ist es unwahrscheinlich, dass viele seiner Einwohner dort arbeiten werden. Arbeitsplatzanforderung, Berufsausbildung und Berufswunsch müssen zusammenpassen – und das ist in einer hochgradig arbeitsteiligen Gesellschaft selten der Fall.
Neue Straßen erzeugen neuen Autoverkehr
Übermäßiger Autoverkehr führt an Engstellen zu Stau. Neue Straßen, breitere Straßen, Tunnel und Brücken lösen das Problem nur kurzfristig, erzeugen langfristig aber noch mehr Autoverkehr. Denn entscheidend ist nicht die Länge einer Fahrstrecke, sondern die Zeit, die benötigt wird, um sie zurückzulegen. Fließt der Autoverkehr, ist Autofahren attraktiv. Fließt er nicht, ist es unattraktiv. Unattraktivität führt zur Suche nach attraktiveren Alternativen. „Staus sind nicht ein Teil des Problems, sondern ein Teil der Lösung“, sagt deshalb der Stadtplaner Stefan Bendiks. Staus führen zum Umdenken – wenn attraktive Alternativen vorhanden sind.
Attraktive Alternativen braucht es sowohl großräumlich als auch kleinräumlich. Nur wenn die zeitlichen Unterschiede nicht allzu groß sind, können sich Bahn und ÖPNV gegenüber dem Auto als gleichwertige Alternative behaupten. Dabei sind auch die Fußwege einzurechnen. Je kürzer die Wege zur nächsten ÖPNV-Haltestelle, desto attraktiver der ÖPNV, desto mehr Menschen nutzen ihn, desto kürzer kann sein Takt sein, desto attraktiver ist er wiederum – ein positiver Regelkreis. Sind die Fußwege dagegen zu lang, wird lieber mit dem Auto gefahren. Deshalb sind hohe Einwohnerdichten sinnvoll und notwendig – sowohl in großen als auch in kleinen Städten.
Welche Dichten sind ökologisch sinnvoll?
„Zwischen 100 und 1.000 Einwohner/Hektar sollten Stadtteile im Umkreis ihrer ÖPNV-Stationen aufweisen“, empfiehlt der Stadtforscher Philipp Rode. Weniger als 100 sorgen erfahrungsgemäß dafür, dass die Wege zu den Stationen zu lang sind und der ÖPNV deshalb wenig genutzt wird. Und mehr als 1.000 sind nur mit Hochhäusern möglich, was einen übermäßig hohen Ressourcen- und Energieaufwand pro Quadratmeter Wohnfläche bedeutet.
Bei einem Blick auf die Statistiken fällt auf, dass deutsche Städte relativ niedrige Einwohnerdichten aufweisen. Nur Gründerzeitviertel haben oft mehr als 100 Einwohner/Hektar. In München erreicht der dichteste Stadtteil gerade mal 150, während zum Stadtrand hin die Dichte stufenweise auf 20 absinkt. In anderen deutschen Städten sieht es ähnlich aus. In Wien, der Stadt mit der angeblich höchsten Lebensqualität in Europa, gibt es immerhin einige Stadtteile mit über 200 Einwohnern/Hektar. In Paris ist das die durchschnittliche Dichte für die Gesamtstadt, einige Stadtteile weisen über 400 auf. Stadtteile mit über 1.000 Einwohnern/Hektar gibt es nur außerhalb Europas. In Hongkong erreichen einige Stadtteile mehr als 4.000 – und mit 13.000 wurde hier in den 1990er-Jahren auch der „Weltrekord“ gemessen.
Die oberflächliche Betrachtung von Dichte-Statistiken ist oft irreführend. Zu unterschiedlich sind die Stadtgrenzen definiert: In der einen Stadt gehören große Wälder und Seen noch dazu, in der anderen Stadt nicht mehr. Deshalb ist es eher sinnvoll, Stadtteile oder noch kleinere Einheiten zu betrachten. 100 Einwohner/Hektar sollten als Minimum angestrebt werden, um einen attraktiven ÖPNV und damit eine Verkehrswende möglich zu machen – egal ob in einer Groß-, Mittel- oder Kleinstadt. Und die sollten alle an ein Schienennetz angebunden sein. 100 Einwohner/Hektar – das ist mit verschiedenen Gebäudetypen möglich, allerdings bleibt, je weniger Geschosse die Gebäude aufweisen, desto weniger unbebaute Fläche zwischen den Gebäuden übrig.
Wie viel Dichte verträgt der Mensch?
Dichten zwischen 100 und 1.000 Einwohnern/Hektar mögen aus ökologischen Gründen geboten sein, doch akzeptabel sind sie nur, wenn sie für die Einwohner nicht schädlich sind. Erzeugt Dichte nicht Stress? Und macht Stress nicht krank? Dass die Zusammenhänge nicht so simpel sind, wie mancher denkt, betont der Berliner Psychiater Mazda Adli. Er leitet an der Charité das interdisziplinäre Forschungsprojekt „Neurourbanistik“. Das geht der Frage nach, inwieweit und warum uns unsere gebaute Umgebung gesund oder krank macht. Um dann an Architekten und Stadtplaner konkrete Gestaltungsempfehlungen geben zu können. Erste Ergebnisse hat Adli in seinem Buch „Stress and the City“ zusammengefasst.
Die medizinische Forschung zeigt: Erkrankungen sind meist das Resultat mehrerer Einflussfaktoren. Die schädlichsten sind: hohe Feinstaubkonzentrationen und soziale Isolation. Stress dagegen ist nicht so schlimm wie sein Ruf. Im Deutschen verbinden wir mit Stress vor allem körperliche und seelische Belastung. Im Englischen jedoch bedeutet der Begriff auch Anregung und Stimulierung – und die sind wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. „Die pauschale Verteufelung von Stress ist Unsinn“, sagt der Münchener Psychiater Florian Holsboer. „Würden wir Stress abschaffen, würden unsere körperliche Leistungsfähigkeit und unser Denkvermögen nachlassen. Die wichtigste Voraussetzung dafür, trotz Stress gesund zu bleiben, ist, dass die Stressbelastung nicht lange anhält. Ein Leben in ständiger Hetze und Anspannung ist für die Gesundheit schlecht.“
Stress darf also nicht chronisch werden. Es darf kein Gefühl der Überforderung, Unbeeinflussbarkeit, Ohnmacht, Hilflosigkeit und Angst entstehen. Allerdings hängen das Erleben und Verarbeiten von Stress auch viel von der subjektiven Beurteilung ab, von der inneren Einstellung, von der Haltung. Grundsätzlich gilt: Passiv erlittener Stress ist schlecht, bewusst gewählter und dosierter Stress ist gut.
Damit Stress nicht chronisch wird, sind bei der Stadtgestaltung „Stressbesänftiger“ wichtig: im Nahbereich Bäume, am besten indem Straßen als Alleen gestaltet werden, und in Entfernungen bis 1,5 Kilometer größere Parks. Interessant ist, dass allein schon das Wissen, jederzeit in einen nahegelegenen Park gehen zu können, eine wohltuende Wirkung erzeugt. Grün reicht aber nicht aus. Wichtig ist außerdem, dass die öffentlichen Räume eine hohe Aufenthaltsqualität haben und als Begegnungsorte kreativ genutzt werden können. Und dass die Einwohner bei der Gestaltung ihrer Wohnung und ihres Wohnumfelds mitreden und mitentscheiden können. Keine Passivität, sondern Aktivität! Keine Vereinsamung, sondern Begegnung und Miteinander!
Wissenschaftliche Studien zur Frage, wie eine Stadtstruktur beschaffen sein sollte, damit sich die Menschen wohlfühlen und gesund bleiben, gibt es bislang relativ wenige. Denn die Thematik ist komplex und die Methodik entsprechend schwierig. Auf die Frage, welche Stadt ihm persönlich besonders guttut, gibt Holsboer eine überraschende Antwort: die japanische Hauptstadt Tokio. Als Grund gibt er an, dort gäbe es unzählige kleine Kneipen, Läden, Bars und Restaurants, zudem viele Parks und Gärten, die der Erholung, Besinnung und Entschleunigung dienen. Kleinteiligkeit und Vielfalt sind also wichtig, Lebendigkeit, aber auch Rückzugsorte zum Entspannen. Die Mischung macht‘s.
Welche Mobilität macht glücklich?
Ausführlich widmet sich „Stress and the City“ auch der Verkehrsproblematik. Unter dem übermäßigen Autoverkehr leiden nachweislich alle: die Einwohner und die Autofahrer selbst. So hat die AOK unter ihren Versicherten ermittelt, dass mit steigender Entfernung zum Arbeitsplatz die Zahl der Krankheitstage aufgrund psychischer Beschwerden linear zunimmt. Autofahren stresst – und die sozialen Aktivitäten lassen nach.
Wissenschaftler fanden heraus, dass Radfahrer am entspanntesten und zufriedensten sind, danach folgen Fußgänger und ÖPNV-Nutzer, an letzter Stelle rangieren Autofahrer. Warum das so ist, lässt sich schlüssig erklären: Das Zufußgehen ist uns genetisch einprogrammiert, denn es war für über 100.000 Generationen vor uns die Hauptbewegungsart. Nutzer des ÖPNV haben während der Fahrt Zeit, sich zu entspannen, in sich hineinzuhorchen, nachzudenken, zu lesen oder sich zu unterhalten. Autofahrer dagegen sitzen, sind angespannt – und allein. Radfahrer sitzen auch, bewegen sich dabei aber und sind in ihren Routen hochflexibel. Sie stehen nicht im Stau und können jede Fahrt zu einer kleinen Entdeckungsreise machen.
Für Enrique Peñalosa, Bürgermeister der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá, berühmt geworden für seinen konsequenten Stadtumbau, gehörten die Schaffung eines attraktiven ÖPNV und eines attraktiven Radwegenetzes zu den wichtigsten Maßnahmen. „Radfahren in der Stadt ist wichtig, weil es gut für die Gesundheit ist, weil es den Verkehr entlastet und weil es Gleichheit schafft“, betont er.
Ein Radweg hat für Peñalosa auch eine hohe symbolische Bedeutung: „Weil er zeigt, dass ein Mitbürger auf einem 50-Dollar-Rad genauso wichtig ist wie ein Mitbürger, der einem 100.000-Dollar-Auto durch die Stadt fährt. Eine der entscheidenden Fragen ist nämlich, wie man den wertvollen Straßenraum unter den Menschen aufteilt. Demokratischen Verfassungen erklären, alle Menschen seien gleich. Wenn dem so ist, dann sollten auch alle das gleiche Recht auf den Straßenraum haben. Ein Bus mit 100 Passagieren hat das Recht auf 100-mal mehr Straßenraum als ein Auto.“
Eine gemeinwohlorientierte Verkehrspolitik also. Doch nicht nur das. Zum Gemeinwohl gehört auch die ästhetische Qualität von Gebäuden, Straßen, Plätzen und Parks. Die ist Peñalosa ein großes Anliegen. „Als ich ein sehr junger Student in Paris war, habe ich in einem extrem kleinen Zimmer gelebt, keine Toilette, keine Dusche, nichts. Ich hatte überhaupt kein Geld“, erzählt er. „Aber ich war extrem glücklich. Weil mich die Stadt mit ihrer Schönheit glücklich gemacht hat. Eine Stadt kann einen großen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen glücklicher werden, unabhängig von ihrem Einkommen.“
Onlinetipps
Christina Kunkel
München ist wieder Deutschlands Stau-Hauptstadt
Süddeutsche Zeitung, 09.03.2020
www.sz.de/1.4832763
Philipp Rode
Stadtentwicklung und Verkehr
Umwelt-Akademie, Vortrag, 30.09.2019
www.t1p.de/5no1
Stefan Bendiks
Verkehrsinfarkt oder Verkehrswende?
ÖDP-München, Vortrag, 06.05.2019
www.oedp-muenchen.de/aktuelles/unsere-vortraege/
Bund Deutscher Architekten, Landesverband Bayern
Gemeinwohl
BDA-Informationen 4.19
www.bda-bund.de/bda-informationen/
Bund Deutscher Architekten, Landesverband Bayern
Chancen für Stadt und Land
BDA talk, Debatte, 27.09.2019
www.bda-talk.de
Mazda Adli u. a.
Neurourbanistik
Interdisziplinäres Forschungsprojekt
www.neurourbanistik.de
Buchtipp
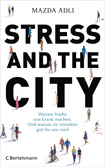 Mazda Adli
Mazda Adli
Stress and the City
Warum Städte uns krank machen. Und warum sie trotzdem gut für uns sind
Bertelsmann, Mai 2017
384 Seiten, 19.99 Euro
978-3-570-10270-1




