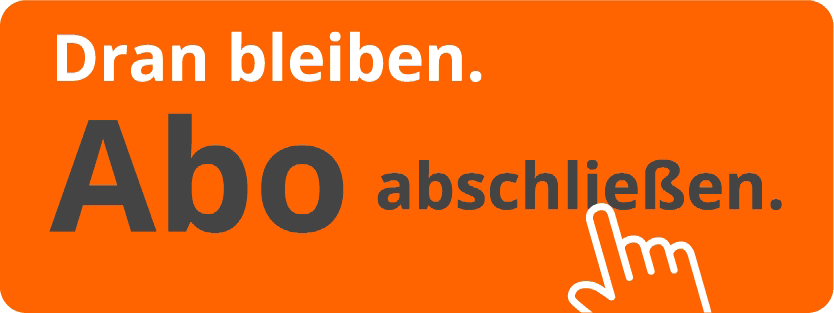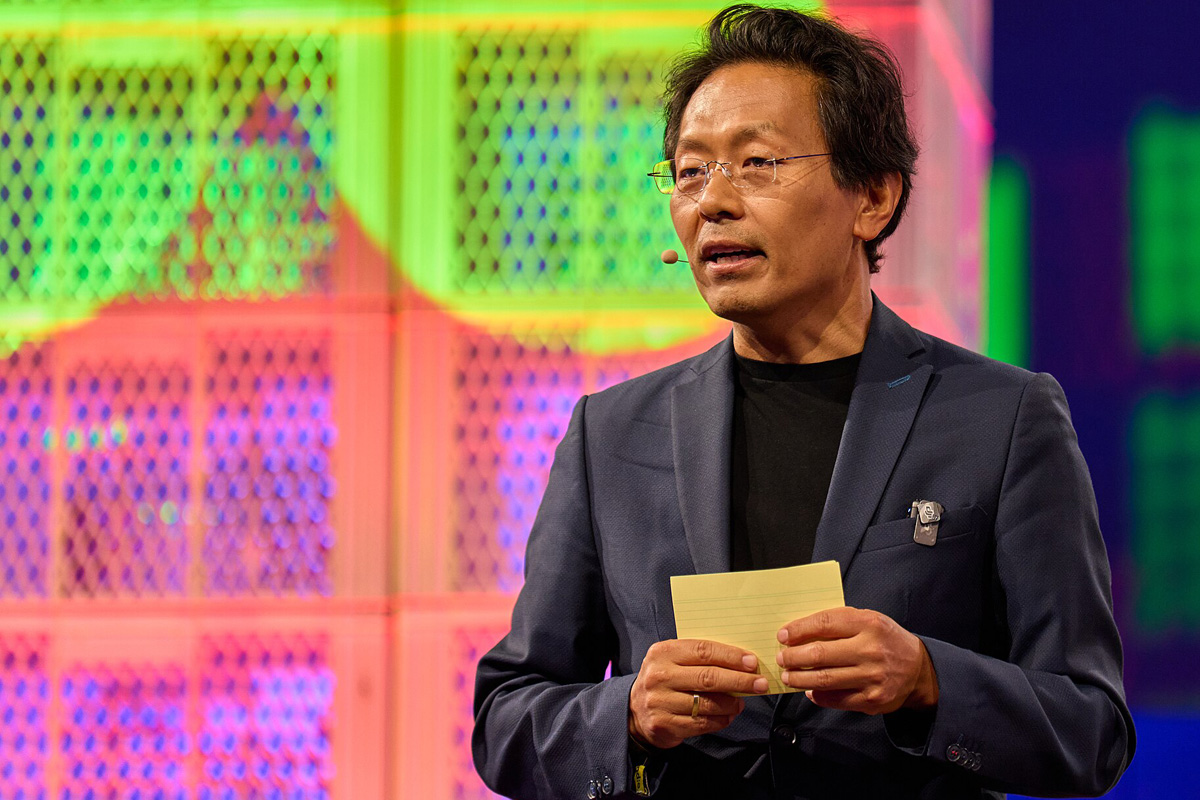
Wie viel Regulierung braucht das Netz?
17. November 2025
Das Internet erscheint als ein Ort der Freiheit, Offenheit und Innovation. Doch dahinter tobt ein Machtkampf: zwischen globalen Tech-Konzernen, die sich nationalen und europäischen Regeln zu entziehen versuchen, und einer EU, die zunehmend begreift, dass die Freiheit mit konsequent angewandtem Recht geschützt werden muss. Der Jurist Chan-jo Jun begleitet diesen Konflikt seit Jahren.
von Thomas Löb
Chan-jo Jun ist Sohn südkoreanischer Einwanderer, wollte ursprünglich Journalist werden, studierte dann aber Jura, war im Staatsexamen Jahrgangsbester, hätte Karriere in einer Großkanzlei machen können – und gründete stattdessen 2001 seine eigene Kanzlei für IT-Recht. Als er 2015 Strafanzeige gegen Facebook stellte, weil das Unternehmen trotz Hinweisen Hasskommentare nicht löschte, wurde er zur Symbolfigur für den juristischen Widerstand gegen digitale Hetze.
Auf Social Media tritt er als „Anwalt_Jun“ auf, erklärt komplexe Rechtsfragen verständlich und pointiert. Oft ist er Gast in TV-Talkshows und Expertenrunden zur Internetkriminalität und Verbreitung von Fake News. 2022 erhielt er den „Max-Dortu-Preis für Zivilcourage und gelebte Demokratie“ der Stadt Potsdam sowie den „For..Net Media Award“ des „TUM Center for Digital Public Services“ für herausragendes Engagement um die mediale Vermittlung der Digitalen Transformation verliehen, 2023 den „Bayerischen Verfassungsorden“.
Juns zentrale These: Europa hat längst gute Regeln geschaffen – aber es fehlt am Mut, sie auch durchzusetzen.
Der Geburtsfehler des Internets: das CompuServe-Urteil
Die Geschichte der digitalen Regulierung beginnt mit einem Justizirrtum. 1998 verurteilte ein Münchner Gericht den Geschäftsführer der damaligen Online-Plattform CompuServe zu zwei Jahren auf Bewährung, weil über deren Server kinderpornografische Inhalte verbreitet wurden. Obwohl das Urteil in der Berufung aufgehoben wurde, hinterließ der Fall tiefe Spuren in der Rechtsprechung. Aus Sorge, die junge Internetwirtschaft im Keim zu ersticken, etablierte der Gesetzgeber das sogenannte Haftungsprivileg: Plattformen haften nicht für rechtswidrige Inhalte – solange sie keine Kenntnis davon haben.
Was einst als Schutzschild für Start-ups gedacht war, wurde zur juristischen Festung für globale Tech-Giganten. Jun nennt dieses Prinzip den „Geburtsfehler des Internets“: Eine Regel, die einst Innovation fördern sollte, dient heute als Schutzwall für milliardenschwere Konzerne.
Vom Facebook-Selfie zum europäischen Regelwerk
Zwei Jahrzehnte später zeigte ein anderer Fall, wie gefährlich diese Haltung geworden war. 2015 machte der syrische Geflüchtete Anas Modamani ein Selfie mit Angela Merkel. Das Bild verbreitete sich rasant – und wurde in rechtsextremen Netzwerken für Falschmeldungen missbraucht. Facebook weigerte sich, die Desinformationen zu löschen. Jun klagte – und verlor.
Doch der Fall setzte eine politische Dynamik in Gang: Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) entstand und wurde später zum Vorbild für den Digital Services Act (DSA) und den Digital Markets Act (DMA) der EU. Diese Gesetze markieren einen Paradigmenwechsel: Erstmals werden große Plattformen verpflichtet, systematisch gegen illegale Inhalte, Desinformation und Machtmissbrauch vorzugehen – digitale „Selbstregulierung“ wird zur gesetzlichen Pflicht.
Regulierung als Ausdruck demokratischer Souveränität
Kritiker werfen der EU vor, sie überziehe das Netz mit Vorschriften – von der DSGVO über DSA und DMA bis zum AI Act. Doch Regulierung ist kein Übergriff, sondern Ausdruck politischer Selbstbehauptung. Jun betont: Die Alternative zur Regelbindung ist nicht mehr Freiheit, sondern digitale Anarchie. Freiheit ohne Grenzen sei stets das Recht des Stärkeren – und damit das Ende gleichberechtigter Teilhabe. Die EU versucht, technologische Macht demokratisch zu bändigen. Fehler bleiben nicht aus, doch Gesetze wie der AI Act verdienen Nachbesserung – keine Abschaffung.
Datenschutz ist kein Luxus, sondern Voraussetzung
Wie eng Regulierung und Alltag verknüpft sind, zeigt ein alltägliches Beispiel: Wer einem Angehörigen über WhatsApp eine Gesundheitsnachricht schreibt, sieht kurz darauf passende Werbung auf Instagram. Solche Erlebnisse machen deutlich: Datenschutz ist kein Luxusgut, sondern Grundlage digitaler Selbstbestimmung. Künstliche Intelligenz verschärft das Problem – sie verknüpft verstreute Datenpunkte zu Persönlichkeitsprofilen, die kaum kontrollierbar sind. Datenschutz, so Jun, ist keine Innovationsbremse, sondern ethische Voraussetzung für technologischen Fortschritt.
Europas Gesetze – und das Vollzugsdefizit
Das rechtliche Fundament ist gelegt: DSGVO, DSA, DMA – die EU verfügt über ein umfassendes digitales Regelwerk. Doch in der Praxis bleibt vieles folgenlos. Verfahren gegen Tech-Konzerne ziehen sich über Jahre, Bußgelder sind selten oder zu niedrig, um Wirkung zu entfalten. Jun spricht von „Schaufensterregulierung“: Gesetze, die auf dem Papier stark wirken, aber in der Umsetzung versagen. Dabei hätte die EU als größter Binnenmarkt der Welt die Macht, globale Standards zu setzen – wenn sie diese nur entschlossen durchsetzen würde.
Strategische Klagen als Hebel für mehr Rechtsklarheit
Wo der politische Wille fehlt, setzen Juristen wie Jun auf strategische Klagen. Gemeinsam mit dem Faktencheck-Portal „Volksverpetzer“ verklagte er die Plattform X (ehemals Twitter), weil diese gefälschte Accounts nicht löschte. Der Fall hat Signalwirkung: Er soll nicht nur individuelles Recht durchsetzen, sondern Rechtsklarheit schaffen – und anderen Betroffenen den Weg ebnen. Solche Verfahren entfalten auch gesellschaftliche Wirkung, weil sie zeigen: Digitale Grundrechte sind einklagbar.
Lobbyismus in Brüssel – und die stille Zivilgesellschaft
Warum bleibt Europa so zögerlich? Jun sieht die Ursache in einem strukturellen Ungleichgewicht: In Brüssel agieren Tech-Konzerne mit hochprofessionellem Lobbyismus, ausgestattet mit Netzwerken, Ressourcen und Einfluss. Eine vergleichbar starke Lobby für Datenschutz, Grundrechte oder Verbraucherinteressen existiert kaum. Dieses Machtgefälle prägt viele Gesetzgebungsprozesse – und erklärt, warum die Durchsetzung oft halbherzig bleibt.
Europas unterschätzte Stärke: die Rule of Law
Trotz aller Defizite bleibt Jun optimistisch. Seine Hoffnung gründet auf der Rule of Law – dem rechtsstaatlichen Fundament der EU. Europa muss Big Tech nicht fürchten – wenn es handelt. Die Union verfügt über klare Gesetze, unabhängige Gerichte und die Legitimation, Regeln durchzusetzen. Kein globaler Konzern kann es sich leisten, den europäischen Markt zu ignorieren. Die entscheidende Frage ist nicht, ob Europa genug Macht hat – sondern ob es bereit ist, sie zu nutzen. Digitale Souveränität entsteht nicht durch Abschottung, sondern durch konsequente Anwendung des eigenen Rechts.
Europa darf sich nicht kleiner machen, als es ist
Jun ist überzeugt: Europa unterschätzt sich selbst. Als zweitgrößter Wirtschaftsraum der Welt kann die EU Standards setzen – für Datenschutz, faire Plattformen und verantwortungsvolle KI. Die Lehre aus drei Jahrzehnten Internetgeschichte ist für ihn eindeutig: Das Netz braucht Regulierung – nicht, um es zu bremsen, sondern um es zukunftsfähig zu machen. Das digitale Zeitalter ist längst kein rechtsfreier Raum mehr. Doch solange Regeln nur auf dem Papier stehen, behalten die Stärkeren das Sagen. Europas größte Stärke liegt nicht in Daten oder Rechenzentren – sondern im Recht. Und das ist, richtig angewendet, die schärfste Waffe gegen Big Tech.
Onlinetipps
Jun Legal GmbH
Kanzlei-Homepage
https://jun.legal/
Interview mit Chan-jo Jun
DSA, AI Act & Co: So bändigt Europa Big Tech
Neuland Talk, 05.11.2025
http://y2u.be/zLFY1hp839Q
Chan-jo Jun, Jessica Flint
Machtfaktor Social Media
re:publica, 26.05.2025
http://y2u.be/XjJKKCkTbzw