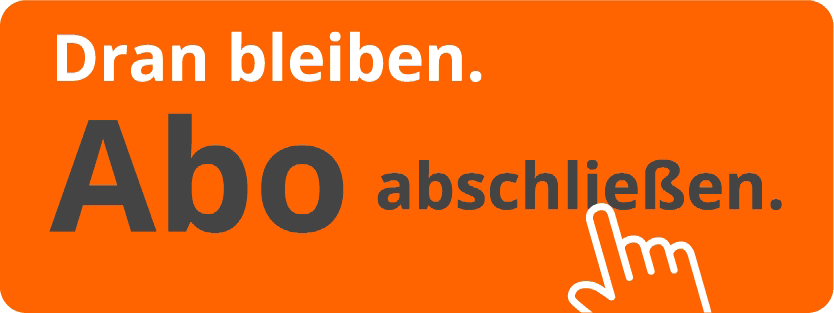„Die ÖDP bekannter machen“
3. September 2025
Zur Ausgabe 200 ein Rollentausch: Der Verantwortliche Redakteur lässt sich von einem ÖkologiePolitik-Leser befragen. Von einem alten ÖDP-Weggefährten – wie bereits 2011 zur Ausgabe 150.
Interview mit Günther Hartmann
Paul Holmes: Günther, was hat sich bei der ÖkologiePolitik seit unserem letzten Interview vor 14 Jahren getan?
Günther Hartmann: Das Heft wurde zweimal konzeptionell und gestalterisch stark überarbeitet – und zu dieser Jubiläumsausgabe leicht. Vor rund 8 Jahren kam der eigene Internetauftritt hinzu. Und schon vorher mit Mirjam Karasek eine Toplektorin ins Team. Kurz: Wir wurden professioneller und erreichen neben den Parteimitgliedern heute auch eine breite Öffentlichkeit.
Wie hat sich die Mediennutzung in den letzten 14 Jahren verändert?
Es wird sehr viel weniger gelesen. Bei den Printmedien sank die durchschnittliche Lesedauer in den letzten zwei Jahrzehnten von 57 auf 9 Minuten pro Tag. Nimmt man die Internetmedien hinzu, lesen die Deutschen heute 27 Minuten pro Tag, die 30- bis 44-Jährigen 13 Minuten, die 18- bis 29-Jährigen 11 Minuten. Die Bereitschaft, mit dem Lesen eines Textes zu beginnen, nahm also stark ab. Und die Bereitschaft, das Lesen bereits kurz nach dem Beginn abzubrechen, zu.
Wie lässt sich die Lust aufs Lesen wecken? Und aufrechterhalten?
Mit interessanten Themen. Mit Überraschungen. Und mit journalistischem Handwerk: ansprechender Gestaltung und guter Lesbarkeit.
Wie entsteht gute Lesbarkeit?
Durch lapidare Sätze und eine klare Struktur. Was beim Lesen nervt, sollte raus – oder zumindest auf ein erträgliches Maß reduziert werden: Wiederholungen, Phrasen, Floskeln, Füllwörter, Hilfs- und Heuchelverben, Schachtelsätze. Es gilt: Weniger ist mehr!
Optimierst du die Beiträge für Suchmaschinen?
Nein. Wie viele andere Journalisten stehe ich dem skeptisch gegenüber. Was nützt es, wenn ein Text bei Google oben gelistet ist und aufgerufen wird, den Leser aber nicht anspricht, sondern anödet? Dann klickt er ihn nach kurzer Zeit weg und nichts ist gewonnen. Der Google-Algorithmus funktioniert anders als das menschliche Gehirn. Suchmaschinenoptimierte Texte sind nicht gehirngerecht.
Was ist gehirngerecht?
Da Lesen evolutionär betrachtet eine sehr junge Kulturtechnik ist, besitzt unser Gehirn kein eigenes Lesezentrum, sondern lässt diese Aufgabe von mehreren Gehirnteilen – von der relativ jungen Großhirnrinde bis zum uralten „Reptiliengehirn“ – gemeinsam erledigen. Deshalb ist Lesen eine sehr emotionale Tätigkeit. Unser Gehirn arbeitet dabei nicht linear, sondern mäandert – wie ein Fluss in der Landschaft. Ein Text muss unsere alten Gehirnteile stimulieren. Er darf nicht langweilen und nicht nerven, nicht unterfordern und nicht überfordern.
Der Google-Algorithmus ist auch intransparent und sehr kommerziell ausgerichtet.
Ja, da hast du recht. Er ändert sich auch immer wieder, entzieht sich den Textoptimierungsstrategien.
Wie werden eure Artikel und Interviews dann bekannt?
Vor allem über Empfehlungen – in Social-Media-Kanälen, per E-Mail oder im Internet. Wenn z. B. in den „Hinweisen des Tages“ der „NachDenkSeiten“ ein Beitrag der ÖkologiePolitik dabei ist, schießen unsere Klickzahlen steil nach oben.
Wie oft kommt das vor?
Bei der letzten Ausgabe über Demokratie schafften es 5 Beiträge in die „Hinweise des Tages“. Und bei 3 dieser Beiträge hatten wir an den Tagen jeweils über 1.000 Besucher.
Welche Ziele verfolgt die ÖkologiePolitik?
Sie ist zum einen natürlich eine Mitgliederzeitschrift, die über parteiinterne Geschehnisse berichtet – wofür mein geschätzter Kollege Jan Altnickel zuständig ist. Zum anderen dient sie der politischen Willensbildung, will Denkanstöße geben und zu Diskussionen anregen – früher nur parteiintern, seit unserem eigenen Internetauftritt auch außerhalb. Damit ist die ÖkologiePolitik ein wichtiges Instrument, um die ÖDP bekannter zu machen. Die Metabotschaft lautet: Die ÖDP ist eine interessante Partei, die spannende und richtungsweisende Diskussionen führt. Sie ist keine 1-Thema-Partei, sondern deckt alle wichtigen Politikfelder ab. Sie wäre in unseren Landtagen und dem Bundestag eine positive Bereicherung.
Welche ist deine Lieblingsausgabe?
Die nächste Ausgabe sollte natürlich immer die beste sein – unabhängig vom Thema. Aber wenn ich so zurückdenke: Die Ausgabe „Was bedeutet Mitte?“ war mir wichtig. Zum einen, um die aktuellen Strömungen an den rechten und linken Rändern unseres politischen Spektrums darzustellen und kritisch zu beleuchten. Zum anderen, weil die politische Mitte häufig mit Anpassung an den politischen Mainstream verwechselt wird. Diesem Missverständnis wollte ich etwas entgegensetzen, der politischen Mitte sozusagen ein klareres Profil mit Ecken und Kanten verleihen. Inwieweit das gelang, mögen andere beurteilen.
Wie sieht es mit der Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland aus?
Auch wenn Deutschland im Ranking der „Reporter ohne Grenzen“ erstmals aus den Top Ten gerutscht ist: Wir haben Meinungs- und Pressefreiheit! Die gehört zum Wesen der Demokratie und macht den Unterschied zu autoritären Systemen. Darüber sollten wir froh sein.
Der britische „Economist“ warnte kürzlich, die Meinungsfreiheit in Deutschland sei gefährdet.
Da ging es vor allem um ein eher harmloses Satire-Meme, das ein Journalist verbreitete. Die darin verspottete Nancy Faeser, damals Bundesinnenministerin, zeigte ihn an. Und ein Gericht verurteilte ihn dann tatsächlich zu einer 7-monatigen Bewährungsstrafe. Satire über Spitzenpolitiker ist inzwischen heikel. Aber die Meinungsfreiheit ist dadurch noch nicht bedroht. Das Problem ist eher, dass die großen Leitmedien diese wenig nutzen und meist sehr einseitig und gleichförmig berichten. Oder nicht berichten.
Warum tun sie das?
Wahrscheinlich haben die Journalisten schlichtweg Angst. Wer heute vom Meinungsmainstream abweicht, wird schnell verspottet, angefeindet, verunglimpft, mit einem Shitstorm überzogen, geächtet. Das ist unangenehm. Das mag niemand. Das kann die berufliche Karriere bei einer Tageszeitung oder einem Sender bremsen oder beenden.
In unserem Interview zur Ausgabe 150 sagtest du, dass es dir angenehm ist, nicht neutral bleiben zu müssen wie die Journalisten großer Zeitungen.
Tja, damals war ich noch jung und naiv. Neutral zu sein, würde bedeuten, über verschiedene Positionen und Perspektiven zu berichten. Das geschieht heute kaum noch. Im Wirtschaftsjournalismus z. B. wird die Wirklichkeit fast ausschließlich durch die neoliberale bzw. neoklassische Brille betrachtet und gefiltert.
Bedroht die EU-Verordnung „Digital Services Act“ die Meinungs- und Pressefreiheit?
Die beunruhigt mich nicht, denn ich verbreite ja keine Desinformation. Nein – Spaß beiseite: Sicherlich könnte sie missbraucht werden, um Journalisten und Bürger einzuschüchtern, um den öffentlichen Meinungskorridor weiter zu verengen, um die Verbreitung unangenehmer Wahrheiten einzuschränken, um kritische Geister mundtot zu machen. Aber das ist spekulativ. Vielleicht lässt sich dadurch auch verhindern, dass unsere Spitzenpolitiker Desinformationen verbreiten. Das tun sie derzeit häufig – und kommen damit so gut wie immer durch.
US-Vizepräsident J. D. Vance warf auf der Münchner Sicherheitskonferenz den Europäern vor, die Meinungsfreiheit abschaffen zu wollen.
Solche Angriffe sind eine beliebte Technik von Trump, um seine Gegner in die Defensive zu drängen. Das war wohl aber auch ein spöttischer Seitenhieb auf die europäischen Regierungen und eine Anspielung auf eines von Trumps Erfolgsrezepten: das bewusste Brechen von Tabus. Trump sprach aus, was viele Menschen dachten, was aber nicht mehr offen gesagt werden durfte. Das Brechen dieser Tabus erzeugte bei diesen Menschen ein starkes Gefühl von Erleichterung und Befreiung. Und führte zu einer absurd anmutenden Begeisterung für Trump.
Was können wir daraus lernen?
Dass Meinungen nicht unterdrückt, dass Missstände nicht schöngeredet, kleingeredet oder totgeschwiegen werden dürfen. Es muss ausgesprochen und öffentlich diskutiert werden, was Menschen bewegt. Sachlich, mit Argumenten, nicht mit persönlichen Verunglimpfungen. Die heute um sich greifende Cancel-Culture untergräbt unsere Demokratie.
Nancy Faeser und andere Politiker sehen das anders.
Ja, leider. Gerade Faeser zeigte des Öfteren ein bedenkliches Demokratieverständnis. Eine offene Diskussionskultur gehört zur Demokratie und ist ihre große Stärke! Demokraten sind wir nur, wenn wir missliebige Meinungen aushalten und uns die Mühe machen, sie argumentativ zu widerlegen, nicht, wenn wir sie verbieten. Aber unter uns gesagt: Auszusprechen, was falsch läuft, ist für kleine Parteien wie die ÖDP eine große Chance.
Günther, herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
Paul Holmes und Günther Hartmann saßen von 2000 bis 2006 im Vorstand des ÖDP-Kreisverbands München-Mitte. Das obige Gespräch fand im Juli 2025 im Biergarten des Münchener Hofbräukellers statt. Es wurde für diese Veröffentlichung gekürzt und redaktionell bearbeitet. Das erwähnte Interview zur Ausgabe 150 kann als PDF hier heruntergeladen werden: www.t1p.de/pqp80
Onlinetipps
Raphael M. Bonelli
Tabubruch: Der Fall der woken Mauer
Pragmaticus, 07.06.2025
www.t1p.de/sa130
Interview mit Michael Meyen
„Sprachrohr der Eliten“
NachDenkSeiten, 21.05.2025
www.nachdenkseiten.de/?p=133231
Helge Buttkereit
Medienkritik: Mehr als trotziger Idealismus
Multipolar, 17.04.2025
www.t1p.de/tb7p1
Interview mit Sabine Schiffer
Medienbildung für die Demokratie
Overton, 26.03.2025
www.t1p.de/cdmnx
Interview mit Andreas Jungherr
„Warnungen vor Desinformation als große Gefahr für die Demokratie sind übertrieben“
PW-Portal, 16.03.2025
www.t1p.de/47jay
Interview mit Alexander Teske
Tagesschau: Aktivistisch, angepasst und abgehoben
Telepolis, 04.02.2025
https://telepolis.de/-10269094
Ole Skambraks
Meinungsvielfalt jetzt!
Manifest, März 2024
https://meinungsvielfalt.jetzt/manifest.html