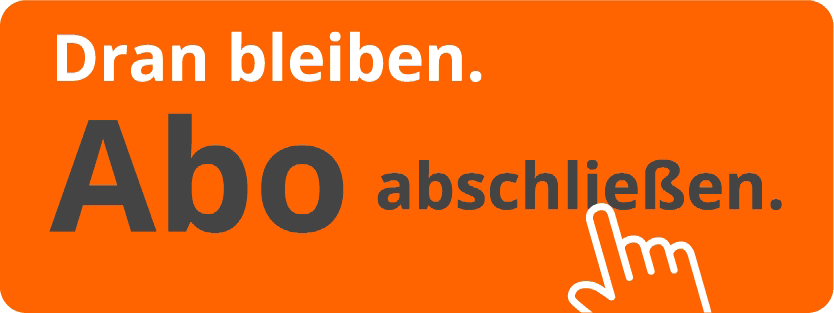Polizeizukunft: KI-Wahrscheinlichkeit statt Unschuldsvermutung?
12. August 2025
Jeder digitale Fußabdruck wird systematisch analysiert und bewertet – nicht zur Aufklärung begangener Straftaten, sondern zur Berechnung eines „Verbrechenskoeffizienten“. Und die Polizei greift ein, bevor überhaupt etwas passiert ist. Das klingt wie eine düstere Zukunftsvision, ist aber teilweise schon Realität.
von Thomas Löb
In den USA gehört „Predictive Policing“ bereits zum Alltag. Und auch deutsche Bundesländer wie Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen setzen zunehmend auf diese Technologie. Dabei geht es um datenbasierte Analyseverfahren, die darauf abzielen, potenzielle Tatorte, Täterprofile und Zeitpunkte zukünftiger Straftaten statistisch vorherzusagen – mit dem Ziel, polizeiliche Maßnahmen vorausschauend zu steuern. Im Zentrum steht das US-Unternehmen Palantir Technologies, gegründet von Peter Thiel – einem umstrittenen Tech-Milliardär mit Nähe zu Donald Trump und libertären Positionen, dessen Verhältnis zur Demokratie sehr eigen ist.
„Gotham“ kann riesige Datenmengen analysieren
Thiels Software „Gotham“ gilt als eines der weltweit leistungsfähigsten, zugleich aber auch umstrittensten Datenanalyse-Tools. Sie ermöglicht staatlichen Behörden die automatisierte Auswertung riesiger Datenmengen und wird international von Geheimdiensten, Militärs und Polizeibehörden eingesetzt – auch in Deutschland, etwa durch das Bundeskriminalamt, und künftig in Baden-Württemberg. Ursprünglich zur Terrorbekämpfung entwickelt, kam Gotham erstmals im Afghanistan-Krieg zum Einsatz und verarbeitet heute unter anderem Satelliten- und Drohnendaten, etwa im Ukraine-Krieg. Palantir ist ein zentraler Technologiepartner der Ukraine und bekannt für seine enge Zusammenarbeit mit der CIA und der NSA.
Die Vision der Gründung: Technologie soll die Grenzen zwischen Sicherheit und Freiheit neu definieren. Doch der Einsatz in deutschen Bundesländern wirft gravierende rechtliche und ethische Fragen auf. Kritiker warnen vor einer gefährlichen Abhängigkeit öffentlicher Stellen von einem privaten US-Konzern, dessen intransparente Systeme tief in die Privatsphäre eingreifen und rechtsstaatliche Prinzipien herausfordern. Besonders brisant: Palantir verweigert Medienzugang und entzieht sich öffentlicher Kontrolle. In einer Zeit, in der datengetriebene Systeme zunehmend über Freiheit und Sicherheit mitentscheiden, braucht es klare rechtliche Grenzen, demokratische Kontrolle und eine breite gesellschaftliche Debatte über die Rolle solcher Technologien.
Prognosen ersetzen Unschuldsvermutung
Denn der Preis für diese vermeintliche Effizienz ist hoch: Privatsphäre, Selbstbestimmung und Freiheit geraten zunehmend unter Druck. Statt tatsächlicher Taten zählen statistische Wahrscheinlichkeiten, und die Unschuldsvermutung wird durch algorithmische Prognosen ersetzt. Wer nicht ins Raster passt, wird ausgeschlossen – ohne Widerspruchsmöglichkeit oder datenschutzrechtliches „Opt-out“. Die dauerhafte Überwachung verändert das Verhalten der Menschen. Nach den Snowden-Leaks etwa ging die Zahl islambezogener Wikipedia-Recherchen deutlich zurück – ein Beispiel für die Wirkung subtiler Selbstzensur. Ein einziger Fehler im System kann genügen, um Unschuldige ins Visier zu bringen oder gar zu inhaftieren. Gleichzeitig bleibt die Kontrolle über diese Systeme mangelhaft: Parlamentarier erhalten nur eingeschränkten Einblick, Datenschutzbeauftragte haben lediglich beratende Funktion, und die Algorithmen bleiben geheim.
In Deutschland wächst die Kritik am Einsatz der US-Software. Datenschützer und Bürgerrechtler warnen vor tiefgreifenden Eingriffen in die Grundrechte, da Gotham innerhalb von Sekunden personenbezogene Daten, Vorstrafen und Social-Media-Inhalte verknüpft – auch von unbescholtenen Bürgerinnen und Bürgern. In mehreren Bundesländern erfolgt die Datenauswertung teils ohne konkreten Verdacht oder richterliche Kontrolle. Organisationen wie die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) und der Chaos Computer Club kritisieren die Intransparenz der Algorithmen sowie die rechtsstaatlich bedenkliche Vermischung von Datenquellen und Einsatzzwecken. Die durch Gotham erzeugten Risikoprofile können Menschen vorverurteilen und gefährden die informationelle Selbstbestimmung.
Dobrindt will Technologie landesweit einsetzen
Verträge und technische Details bleiben unter Verschluss, Entscheidungsprozesse sind für die Öffentlichkeit kaum nachvollziehbar. Kritiker befürchten eine schleichende Militarisierung der Polizei, wenn ursprünglich militärische Technologien auf die zivile Sicherheitsarbeit übertragen werden. Auch Kriminologen wie Tobias Singelnstein und Juristinnen wie Franziska Görlitz bezweifeln die Wirksamkeit solcher Systeme und warnen vor Datenlecks sowie intransparenten Verarbeitungsprozessen. Die GFF hat bereits erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt, weitere Beschwerden sind anhängig. Die zentrale Frage lautet: Wer zieht die Grenze – und wo?
Auch politisch ist der Einsatz von Palantir umstritten. Während die frühere Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eine bundesweite Einführung ablehnte, möchte ihr Amtsnachfolger Alexander Dobrindt (CSU) diese Technologie landesweit zum Einsatz bringen. Eine Petition gegen den Einsatz der Software fand binnen einer Woche über 260.000 Unterstützer – ein deutliches Zeichen zivilgesellschaftlicher Besorgnis.
ÖDP fordert demokratische Sicherheitskultur
Diese fortschreitende Digitalisierung der Polizeiarbeit wirft grundlegende verfassungsrechtliche und gesellschaftspolitische Fragen auf. Parteien wie die ÖDP fordern eine demokratische Sicherheitskultur, die den Menschen ins Zentrum stellt und sich gegen technokratische Überwachung sowie privatwirtschaftliche Abhängigkeiten ausspricht. Sicherheit dürfe nicht zur Rechtfertigung für invasive Technologien werden, sondern müsse stets mit Freiheit vereinbar bleiben.
Besonders kritisch ist die Missachtung der Zweckbindung im Datenschutzrecht: Daten dürfen nur für den ursprünglichen Zweck verwendet werden, doch viele polizeiliche Systeme speichern und verarbeiten sie ohne klare Kennzeichnung. Palantir wird von Behörden als Lösung für strukturelle Versäumnisse gefeiert, doch diese Euphorie verdeckt die massiven Eingriffe in die Privatsphäre. Der bayerische Datenschutzbeauftragte Thomas Petri warnt eindringlich vor einer Ausweitung ohne rechtliche Kontrolle.
Angesichts der geopolitischen Abhängigkeit von US-amerikanischen Technologieanbietern und dem Mangel an europäischen Alternativen fordern Fachleute und zivilgesellschaftliche Organisationen mehr Transparenz, unabhängige Kontrolle und die gezielte Förderung datenschutzkonformer Lösungen. Eine herstellerunabhängige Technologie, die rechtsstaatliche Prinzipien achtet und demokratische Integrität schützt, ist längst überfällig.
Überwachungsstaat versus Freiheit und Demokratie
Die Debatte um Palantir zeigt exemplarisch, wie datengetriebene Überwachungstechnologien die fragile Balance zwischen Sicherheit und Freiheit ins Wanken bringen. Programme wie Gotham versprechen eine effizientere Verbrechensbekämpfung, doch ihr Einsatz wirft tiefgreifende rechtliche und ethische Fragen auf. Kritiker warnen vor intransparenter Datenverarbeitung, fehlender Zweckbindung und einer schleichenden Entwicklung hin zum Überwachungsstaat. Besonders bedenklich ist die enge Verflechtung Palantirs mit US-Geheimdiensten sowie die undurchsichtige Finanzierung durch die amerikanische Muttergesellschaft – Aspekte, die Zweifel an der Neutralität und Unabhängigkeit der Technologie nähren.
Dabei ermüdet die Wiederholung immer gleicher Erfolgserzählungen – etwa des angeblich verhinderten Terroranschlags 2018 in Hessen. Seit über zwei Jahrzehnten wird behauptet, dass erweiterte Befugnisse und bessere technische Ausstattung Terroranschläge vereiteln, Clankriminalität bekämpfen und Kinderpornografie eindämmen könnten. Doch wie belastbar sind diese Versprechungen angesichts realer Ereignisse wie dem Anschlag am Breitscheidplatz, den rassistischen Morden in Hanau, dem Diebstahl einer 100-Kilogramm-Goldmünze aus einem Berliner Museum oder dem spektakulären Raub im Dresdner Grünen Gewölbe?
Notwendig ist eine offene und ehrliche Debatte
Wäre es nicht längst an der Zeit, solche unbelegten Narrative hinter sich zu lassen und stattdessen auf Augenhöhe zwischen Politik, Polizei und Bürgerschaft über realistische und wirksame Maßnahmen in der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung zu sprechen? Wie viel Einschränkung individueller Freiheiten zugunsten staatlich garantierter Sicherheit können, wollen und dürfen wir uns leisten? Wie begegnen wir totalitären und antidemokratischen Tendenzen mit rechtsstaatlicher Wehrhaftigkeit? Und welche Befugnisse für Polizei, Verfassungsschutz und Geheimdienste – vom Mitlesen privater Kommunikation bis zur automatisierten Gesichtserkennung – sind rechtlich zulässig, gesellschaftlich zumutbar und tatsächlich notwendig?
Steht die Losung unter dem Zeichen „Wehret den Anfängen“ mit Blick auf potenzielle Missbrauchsgefahren? Oder lautet sie „Wehrhaftigkeit schafft Sicherheit“, getragen von einem verbreiteten Gefühl der Bedrohung? Wo ziehen wir die Grenze zwischen dem Schutz persönlicher Grundrechte und dem öffentlichen Sicherheitsinteresse?
Diese Fragen verdienen keine pauschalen Antworten, sondern eine offene, ehrliche und differenzierte gesellschaftliche Debatte. Denn wer Sicherheit verspricht, muss auch die Freiheit schützen – und wer Freiheit verteidigt, darf sich nicht blind gegenüber realen Gefahren stellen.
Notwendig sind klare Leitplanken und mehr Transparenz
Während einige Bundesländer bereits auf Palantir setzen, bleibt die gesetzliche Grundlage oft unklar. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht Leitlinien formuliert – etwa die Begrenzung automatisierter Datenanalysen auf konkrete Verdachtsmomente und richterliche Kontrolle –, doch die föderale Umsetzung ist uneinheitlich, und Datenschutzstandards variieren erheblich. Bisherige Projekte zeigen, wie rechtliche Unsicherheiten und mangelnde Transparenz zu ernsthaften Risiken für demokratische Grundprinzipien führen können. Die im Datenschutzrecht verankerte Zweckbindung wird häufig missachtet, personenbezogene Daten ohne klare Kennzeichnung verarbeitet – was eine rechtmäßige Nutzung erschwert und die Gefahr willkürlicher Eingriffe erhöht.
Palantir dominiert den Markt für polizeiliche Datenanalyse, während europäische Alternativen bislang kaum konkurrenzfähig sind. Diese technologische Abhängigkeit bringt Deutschland in eine geopolitisch angreifbare Position und wirft grundlegende Fragen zur digitalen Souveränität auf. Sicherheitsexperten plädieren daher für eine pragmatische, zugleich aber rechtsstaatlich abgesicherte Nutzung solcher Technologien. Die Lösung liegt nicht in pauschaler Ablehnung, sondern in der konsequenten Etablierung klarer Leitplanken: Transparente Algorithmen, parlamentarische Kontrolle und richterliche Genehmigungen müssen den Einsatz begleiten. Nur so lässt sich sicherstellen, dass digitale Werkzeuge der Gefahrenabwehr dienen – und nicht zu Instrumenten flächendeckender Überwachung werden.
Öffentlichkeit ist über komplexe Thematik aufzuklären
Der Fall Palantir zeigt eindrücklich, wie wichtig es ist, komplexe Zusammenhänge öffentlich zu machen und verständlich zu vermitteln. Denn nur eine informierte Gesellschaft kann eine fundierte Debatte über Überwachung, Datenschutz und demokratische Kontrolle führen. Edward Snowden bringt es auf den Punkt: „Zu sagen, dass Ihnen das Recht auf Privatsphäre egal ist, weil Sie nichts zu verbergen haben, ist nichts anderes als zu sagen, dass Ihnen die Meinungsfreiheit egal ist, weil Sie nichts zu sagen haben.“
Die zentrale Frage bleibt: Wie viel algorithmische Macht verträgt eine freiheitliche Demokratie?
Onlinetipps
Hannes Vogel
Trumps Datenkrake: Palantir – das Auge, das alles sieht
ntv, 10.08.2025
www.t1p.de/kiso2
Detlef Koch
Die Software „Palantir“: Der „sehende Stein“ des Überwachungszeitalters
NachDenkSeiten, 04.08.2025
www.nachdenkseiten.de/?p=136921
Marcel Kunzmann
Palantir-Deal in Baden-Württemberg: Kontrolle erst nach dem Kauf
Telepolis, 29.07.2025
https://telepolis.de/-10503103
Günther Burbach
Im Netz der Schattenmacht – Wie Daten uns heute schon entmündigen
Overton, 12.07.2025
www.t1p.de/v7sbk
Jonas Tögel
Die Architektur der Unterdrückung – Wie digitale Identität und Massenüberwachung die Demokratie gefährden
NachDenkSeiten, 02.07.2025
www.nachdenkseiten.de/?p=135402
Michael Lindenau
Sondereinsatzkommandos ante portas?
Overton, 27.03.2025
www.t1p.de/hba26
Rüdiger Suchsland
Hobbit als Herrscher: Palantir und der Wahnsinn der illusionierten Harmlosigkeit
Telepolis, 11.06.2024
https://telepolis.de/-9757797