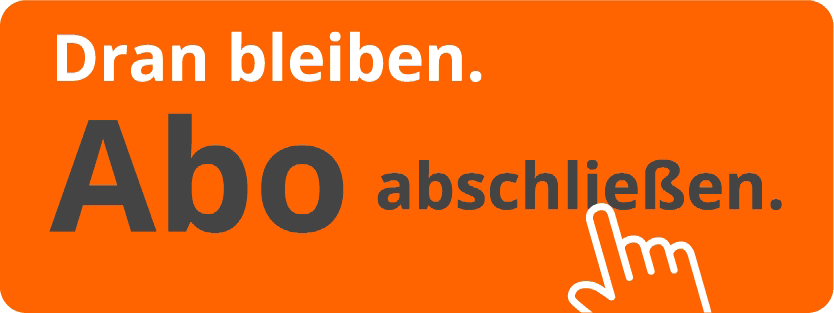Grundgesetzänderung als Paradigmenwechsel
27. August 2025
Unser Rechtssystem definiert die Rechte der Menschen und der von Menschen geschaffenen Organisationen. Die Natur hat keine Rechte. Der Mensch darf sie gestalten, nutzen und sogar zerstören. Auch wenn er sich langfristig damit selbst schadet. Deshalb muss unser Rechtssystem dringend korrigiert werden – ausgehend von der Verfassungsebene.
von Dr. Bernd Söhnlein
Das deutsche Grundgesetz basiert wie die meisten europäischen Verfassungen auf einem humanistischen Menschenbild. Im Mittelpunkt steht die Menschenwürde des Individuums, das innerhalb der sozialen Gemeinschaft ein selbstbestimmtes Leben führen können soll. Den verfassungsrechtlichen Rahmen dafür bildet die freiheitlich-demokratische Grundordnung mit dem Rechtsstaatsprinzip und den Grundrechten. Jeden Eingriff in menschliche Grundrechte muss der Staat mit nachvollziehbaren Gründen rechtfertigen.
Die Kehrseite einer möglichst weitgehenden Freiheit in der eigenen Lebensgestaltung besteht jedoch darin, dass die Menschen die natürlichen Ressourcen, die sie für ihre Freiheitsausübung benötigen, mehr und mehr erschöpfen. Denn dem Grundgesetz liegt stillschweigend ein Selbstverständnis des Menschen zugrunde, den Planeten Erde ausschließlich als seine eigene Umwelt zu betrachten, die er nach seinem Belieben benutzen, umgestalten und nach seinen Regeln verwalten kann.
Grundgesetz fordert Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
Als das Grundgesetz verfasst wurde, war es das zentrale Anliegen, einen Gegenentwurf zum nationalsozialistischen Terrorregime zu schaffen. Das Verhältnis zwischen Mensch und Natur zu klären und eine drohende Klima- und Naturkrise abzuwenden, stand damals nicht auf der Tagesordnung des Verfassungskonvents. Erst im Jahr 1994 hat Deutschland den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen als Verfassungsauftrag ins Grundgesetz aufgenommen.
„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung“, steht seither im Art. 20a GG.
Dass Freiheitsausübung von der Bewahrung der Natur abhängt, hat inzwischen auch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in seiner Entscheidung zum Klimaschutz vom 24.03.2021 anerkannt. Das Gericht knüpft dabei an die Staatszielbestimmung Umweltschutz in Art. 20a GG an, aus der es neben der staatlichen Pflicht zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ein Recht des Einzelnen auf effektive Maßnahmen zum Klimaschutz aus Art. 2 Abs. 1 GG „Allgemeine Handlungsfreiheit“ ableitet.
Wenn die Herausforderungen der Klima- und Naturkrise mithilfe des Staatsziels Umweltschutz und einer entsprechenden Auslegung der Grundrechte zu bewältigen wären, wozu sollte man dann Rechte der Natur in die Verfassung aufnehmen?
Rechtsordnung basiert auf fragwürdigem Mensch-Natur-Verhältnis
Die eigentliche Ursache der Klima- und Naturkrise wurzelt in dem oben beschriebenen Mensch-Natur-Verhältnis: Mensch und Natur werden in unserer Rechtsordnung als etwas getrennt voneinander Existierendes betrachtet. Der Mensch behandelt den Planeten als seine – und nur seine! – Umwelt.
Das Staatsziel Umweltschutz, das zu den bisherigen Strukturprinzipien und Grundrechten des Grundgesetzes lediglich hinzugefügt wurde, ändert nichts an dem auch naturwissenschaftlich überholten Mensch-Natur-Verhältnis. Art. 20a GG lässt offen, an welchen Kriterien sich die Gesetzgebung bei der Berücksichtigung des Staatsziels ausrichten soll. Der unbestimmte Wortlaut ist eine weitere Schwäche dieser Verfassungsnorm.
Erschwert wird die Situation dadurch, dass der parlamentarische Gesetzgeber Einschränkungen menschlicher Freiheitsrechte vor den Bürgerinnen und Bürgern im demokratischen Rechtsstaat nicht nur (verfassungs-)rechtlich begründen, sondern hierfür bei den nächsten Wahlen Rechenschaft ablegen muss. Welche Widerstände und Zerwürfnisse die freiheitsbeschränkenden Corona-Maßnahmen hervorgerufen haben, ist allen noch gegenwärtig.
Rechte der Natur schränken individuelle Freiheitsrechte ein
Ob die Mehrheit der Menschen mit Verweis auf die Staatszielbestimmung Umweltschutz weitgehende Reglementierungen ihrer individuellen Freiheit dulden würden, mag umso mehr bezweifelt werden. Denn die Auswirkungen der Naturkrise in Form von Bodendegradation, Gewässerverschmutzung und Niedergang der biologischen Vielfalt zeigen sich meist nicht akut, sondern gehen schleichend vor sich. Ihre Folgen werden oft erst langfristig sichtbar, sind aber nichtsdestotrotz gravierend und in Teilen unumkehrbar.
Da die Natur aus einem komplexen Netzwerk von Lebewesen besteht, werden Veränderungen von Ökosystemen und deren mittelbare Folgen für das menschliche Leben oft erst erkennbar, wenn es schon zu spät ist. Greift der Staat präventiv in die Grundrechte der heute lebenden Menschen ein, um die Freiheitsausübung in künftigen Wahlperioden oder gar für künftige Generationen zu schützen, steht er unter einem hohen Rechtfertigungsdruck.
Abwägungen zwischen aktuellen Freiheitsbeschränkungen und zukünftigem Freiheitsschutz gehen oft zulasten künftiger Generationen aus, da sich der Gesetzgeber in demokratischen Wahlen regelmäßig die Legitimation für dieses Handeln verschaffen muss. Die Belange der Natur werden als ein Belang unter vielen öffentlichen Belangen wahrgenommen.
Eigenrechte der Natur im Grundgesetz brächten einen Paradigmenwechsel zum Ausdruck: Rechte dienen nicht mehr nur als Mittel, um sich im Verhältnis zu anderen Menschen und der menschlichen Gemeinschaft insgesamt die Möglichkeit zu verschaffen, die Natur für eigene Zwecke zu nutzen. Eine subjektive Rechtsstellung der Natur würde verdeutlichen, dass die individuelle Freiheit des Menschen nicht nur gegenüber der Freiheit anderer Menschen begrenzt wird, sondern auch gegenüber der übrigen lebendigen Mitwelt auf dem Planeten Erde.
Wie Rechte der Natur ins Grundgesetz integriert werden könnten
Die Rechte der Natur dienen letztlich dazu, den Menschen in Ansehung der Natur vor sich selbst zu schützen und ein gemeinsames Überleben auf dem Planeten zu ermöglichen. Es sind mehrere Wege denkbar, wie man die Verfassung um Rechte der Natur ergänzen könnte.
Die Grundgesetzinitiative des „Netzwerks Rechte der Natur“ schlägt vor, den Art. 1 GG um ein Bekenntnis für die Rechte der Natur zu ergänzen und die Grenze der menschlichen Freiheit nicht nur dort zu ziehen, wo die Rechte anderer Menschen, sondern auch die Rechte der Natur verletzt werden.
Ansatzweise werden die Rechte der Natur auch inhaltlich definiert: in einem einleitenden Satz zu Art. 20a GG, wonach jedes Lebewesen das Recht haben soll, im Rahmen natürlicher Kreisläufe, Nahrungsketten und Biotope seiner Natur nach zu leben. Nach Art. 19 Abs. 4 GG sollen die Grundrechte des Menschen auch für die Natur gelten, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.
Diesen Vorschlag greift auch Jens Kersten in seinem Buch „Das ökologische Grundgesetz“ auf, wobei er den geltenden Wortlaut des Art. 19 Abs. 4 GG, der die Grundrechte des Menschen sinngemäß auf juristische Personen anwendbar erklärt, auf „ökologische Personen“ erweitert.
Die menschlichen Grundrechte sinngemäß auf die Rechte der Natur anzuwenden, birgt allerdings das Risiko, die Rechte der Natur als Pendant der subjektiven Rechte von Menschen anzusehen und die Natur mit ihren nicht-menschlichen Lebewesen zu vermenschlichen. Rechte der Natur sollten aber keine Projektionsfläche menschlicher Interessen und Bedürfnisse darstellen.
Anstelle dessen könnte man die Rechte der Natur eigenständig formulieren. Diesen Weg beschreitet die Verfassung Ecuadors. Ihr Art. 71 Abs. 1 gibt der Natur „the right to integral respect for its existence and for the maintenance and regeneration of its life cycles, structure, functions and evolutionary processes“.
In diese Richtung geht auch, trotz der oben erwähnten entsprechenden Anwendung des Art. 19 Abs. 4 GG, die Grundgesetzinitiative des „Netzwerks Rechte der Natur“. Nach dessen Vorstellung soll gemäß Art. 20a Satz 1 GG jedes Lebewesen im Rahmen natürlicher Kreisläufe, Nahrungsketten und Biotope seiner Natur nach leben dürfen.
Auch dieser Weg hat jedoch seine Tücken: Die Natur ist kein statisches Gebilde. Sie verändert sich ständig, auch ohne Zutun des Menschen. Schwerer noch wiegt der Umstand, dass ein Großteil der Landökosysteme – in Mitteleuropa praktisch die gesamte Natur – vom Menschen seit der letzten Eiszeit umgestaltet wurde. Unsere Landschaft ist Kulturlandschaft.
Naturlandschaften gibt es in Deutschland so gut wie nicht mehr. Selbst die winzigen Anteile der Kerngebiete von Nationalparks sind mehr oder weniger von menschlichen Aktivitäten beeinflusst. Welche Natur soll also fortbestehen? Die (Kultur-)Landschaft vor 1.000 Jahren, vor 200 Jahren oder vor 70 Jahren?
Dieser Schwierigkeit könnte man dadurch begegnen, dass man die Rechte der Natur nicht positiv umschreibt, sondern objektive Prinzipien formuliert, die der Staat bei der Gesetzgebung und im Vollzug der Gesetze zu beachten hätte und die in Verbindung mit einer grundrechtsgleichen Rechtsstellung der Natur gegenüber staatlichen Organen geltend gemacht werden könnten.
Vorbild dafür könnte das Allgemeine Freiheitsrecht nach Art. 2 Abs. 1 GG sein, das in Verbindung mit dem objektiven Staatsprinzip des Staatsziels Umweltschutz inhaltlich „aufgeladen“ wird. Wie erwähnt, hat das BVerfG dem Einzelnen aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20a GG ein Grundrecht auf effektiven Klimaschutz und Klimavorsorge zugesprochen. Entsprechend könnte man ein „Allgemeines Grundrecht der Natur“ mit einem „ökologischen Staatsprinzip“ verknüpfen.
Nach Art. 26 des Entwurfs zur chilenischen Staatsverfassung, der im Jahr 2024 in einer Volksabstimmung scheiterte, sollte ein ökologisches Staatsprinzip insbesondere die Prinzipien des technischen Fortschritts, der Vorsorge, der Gefahrenabwehr, der Umweltgerechtigkeit, der Solidarität zwischen den Generationen, der Verantwortung und der Klimagerechtigkeit umfassen.
Konkreter könnte das ökologische Staatsprinzip darauf gerichtet sein, menschliche Auswirkungen auf die planetaren Ökosysteme räumlich, chemisch und physikalisch zu begrenzen und kontinuierlich zu verringern, eine umfassende Kreislaufwirtschaft aufzubauen sowie die biologische Vielfalt zu bewahren und zu fördern.
Infolge der Verfassungsänderung müssten dann auch die Straf-, Zivil- und Verwaltungsgesetze ergänzt und geändert werden. Auf welche Art und Weise und wie umfassend die Rechtsordnung anzupassen wäre, müsste dem demokratisch gewählten Gesetzgeber überlassen werden.
Wie Rechte der Natur vor Gericht einklagbar werden könnten
An einer Entscheidung führt kein Weg vorbei: Die Rechte der Natur müssen Menschen in politischen und gesellschaftlichen Debatten und im Rechtsverkehr zur Sprache bringen. Ohne natürliche oder juristische Personen, die die Rechte der Natur bei der Gesetzgebung sowie in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren vertreten, bleibt ein Grundrecht der Natur weitgehend wirkungslos.
Als Sprecher für die Rechte der Natur kommen entweder einzelne Menschen, Nichtregierungsorganisationen oder vom Staat geschaffene bzw. in den Staatsapparat eingegliederte Institutionen in Betracht.
Vieles spricht dafür, auf Verfassungsebene eine Institution zu schaffen, die sowohl mit einem Recht auf Beteiligung im Gesetzgebungsverfahren als auch mit Mitwirkungs- und ggf. Klagerechten für die Natur ausgestattet ist. Im Zuge der Wiedervereinigung hatte das Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder eine Verfassungsreform zur Diskussion gestellt, die die Einrichtung eines Ökologischen Rates vorsah.
Der Ökologische Rat sollte nach Vorstellungen des Kuratoriums vor allem an der Gesetzgebung im Bund und in den Bundesländern mitwirken, indem er zu Gesetzesvorlagen auf Bundesebene Stellung nimmt. Er sollte auch die Aufgabe haben, Gutachten zu ökologischen Fragen zu erstellen. An diese Überlegungen könnte man anknüpfen.
Vom Gesetzgeber zu beantworten wäre in jedem Fall die Frage, wer die Rechte der Natur in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren geltend machen kann. Wer soll befugt sein, die Rechte der Natur einzufordern? Erfahrungen aus anderen Ländern, wie etwa der Umgang mit den Rechten der Lagune Mar Menor in Spanien, sollten dabei berücksichtigt werden.
Buchtipps
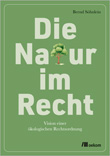 Bernd Söhnlein
Bernd Söhnlein
Die Natur im Recht
Vision einer ökologischen Rechtsordnung
oekom, Oktober 2024
200 Seiten, 26.00 Euro
978-3-98726-122-0
 Jens Kersten
Jens Kersten
Das ökologische Grundgesetz
C.H.Beck, Oktober 2022
241 Seiten, 34.95 Euro
978-3-406-79545-9