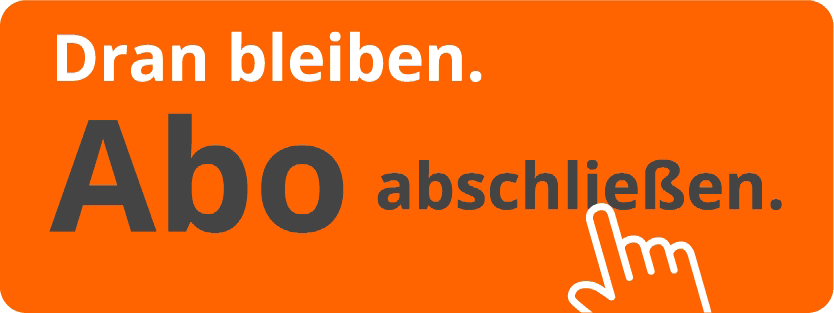Europa braucht dringend mehr digitale Souveränität
3. November 2025
Smartphones, Videokonferenzen, Cloud- und Streamingdienste – fast alle Geräte, Programme und Plattformen stammen aus den USA. Was bequem erscheint, birgt ein tiefgreifendes Risiko: Europas digitale Abhängigkeit. Sie ist nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein politisches Problem. Und gefährdet unsere Demokratie, unseren Datenschutz und unsere Unabhängigkeit.
von Thomas Löb
Ein aktuelles Beispiel aus Brasilien verdeutlicht, wie unmittelbar digitale Macht politisch genutzt werden kann. Im Sommer 2025 ließ US-Präsident Donald Trump den brasilianischen Höchstrichter Alexandre de Moraes wirtschaftlich isolieren: Kreditkarten gesperrt, Online-Konten blockiert, digitale Dienste abgeschaltet – alles auf Anweisung aus Washington. Der Grund: Moraes ermittelte gegen den Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, einen engen Verbündeten Trumps. Als Druckmittel dienten Sanktionen, die über das US-Finanzministerium verhängt wurden.
Was auf den ersten Blick wie ein außenpolitischer Einzelfall wirkt, offenbart in Wahrheit ein globales Machtgefälle: Die USA verfügen dank ihrer technologischen Vormachtstellung über die Möglichkeit, Menschen, Institutionen oder gar ganze Staaten digital auszuschließen. Und Europa ist hiervon direkt betroffen. Unsere Verwaltungen, Universitäten, ja selbst sicherheitsrelevante Behörden basieren auf Systemen, Servern und Software amerikanischer Konzerne.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) im US-Finanzministerium führt Sanktionslisten, auf denen Personen, Unternehmen oder Staaten landen, die aus US-Sicht ihren Interessen zuwiderhandeln. Die Folgen sind drastisch: Vermögenswerte werden eingefroren, Geschäfte untersagt, digitale Zugänge blockiert. Ob Cloud-Dienst, E-Mail-Konto oder Smartphone-Update – alles kann innerhalb weniger Stunden stillgelegt werden.
US-Regierung hat Macht über IT-Konzerne – und deren Kunden
Diese Machtfülle konzentriert sich letztlich in der Hand des US-Präsidenten. Sie wird durch Gesetze wie den International Emergency Economic Powers Act oder den Global Magnitsky Act ermöglicht – und wirkt weit über den Atlantik hinaus. Denn amerikanische Unternehmen müssen sich an US-Recht halten, selbst wenn sie in Europa tätig sind. Der IT-Sicherheitsrechtler Dennis-Kenji Kipker bringt es auf den Punkt: „Wenn ein eigentlich amerikanisches Unternehmen einer US-Anweisung nicht folgt, kann es derart belangt werden.“ Mit anderen Worten: Der politische Wille in Washington genügt, um in Europa wirtschaftliche und digitale Realitäten zu verändern.
Unsere Abhängigkeit ist gewaltig. Drei US-Konzerne – Amazon, Microsoft und Google – beherrschen mehr als 70 % des europäischen Cloud-Markts. Fast alle Verwaltungen, Hochschulen und Unternehmen nutzen Microsoft 365 oder Google Workspace. Auf unseren Smartphones laufen fast ausschließlich iOS oder Android, und auch bei Suchmaschinen, sozialen Netzwerken und Online-Werbung dominieren US-Anbieter.
Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern das Resultat einer jahrzehntelangen Vernachlässigung europäischer Eigenständigkeit. Während die USA und China gezielt in Technologie, Cloud-Infrastruktur und Künstliche Intelligenz investierten, begnügte sich Europa mit Regulierung und Risikominimierung. Datenschutz ist wichtig – aber er ersetzt keine digitale Souveränität.
Zudem ist selbst dieser Datenschutz brüchig. Der CLOUD Act verpflichtet US-Unternehmen seit 2018, Daten auf Anordnung amerikanischer Behörden herauszugeben – unabhängig davon, ob sie in Kalifornien oder Berlin gespeichert sind. Gag Orders verbieten es ihnen sogar, ihre Kundinnen und Kunden darüber zu informieren. Europäische Bürgerinnen und Bürger befinden sich damit de facto unter amerikanischer Rechtsaufsicht.
Zwar versprach der vorherige US-Präsident Joe Biden 2022 mit dem neuen EU-US Data Privacy Framework mehr Transparenz, doch dieses Abkommen beruht allein auf einer Executive Order – also auf politischem Willen, nicht auf Gesetz. Präsident Trump könnte es mit einem Federstrich wieder aufheben. Schon die Vorgängerabkommen, Safe Harbor und Privacy Shield, sind am Europäischen Gerichtshof gescheitert, weil sie keinen wirksamen Schutz boten.
Um unabhängig zu sein, benötigt Europa eigene IT-Infrastruktur
Europa braucht deshalb nicht mehr Bürokratie, sondern Selbstbestimmung. Echte digitale Souveränität bedeutet: eigene Cloud-Infrastrukturen, eigene Softwarelösungen, eigene Standards. Projekte wie Gaia-X zeigen, dass Alternativen möglich sind – eine europäische, föderierte und datenschutzkonforme Infrastruktur, die nach unseren Werten funktioniert. Doch sie wird bislang halbherzig verfolgt und politisch zu wenig priorisiert.
Deutschland importiert jedes Jahr digitale Produkte im Wert von über 60 Mrd. Euro – exportiert aber deutlich weniger. Wir sind im digitalen Bereich vor allem Nutzer, nicht Entwickler. In einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft ist das brandgefährlich. Wenn Industrie 4.0, Bildung, Verwaltung oder Energieversorgung von wenigen außereuropäischen Konzernen abhängen, verlieren wir unsere Handlungsfreiheit – politisch wie wirtschaftlich.
Der digitale Markt ist ein „Winner-takes-all“-System: Wer früh dominiert, beherrscht dauerhaft. Die USA und China haben das verstanden, Europa nicht. Statt gezielt europäische Technologieführer aufzubauen, verlieren wir uns in regulatorischen Details. Es ist höchste Zeit, die Richtung zu ändern.
Europa muss digitale Eigenständigkeit endlich als strategisches Ziel begreifen. Wir brauchen Technologien mit globaler Reichweite – in Bereichen wie Cybersecurity, Edge Computing, industrieller Software und Künstlicher Intelligenz. Wir müssen junge Talente fördern, offene Standards stärken und öffentliche Gelder in europäische Plattformen investieren, statt Lizenzgebühren an US-Konzerne zu überweisen.
Denn digitale Souveränität ist keine technische Nebensache, sondern eine demokratische Notwendigkeit. Wer über unsere Daten, unsere Kommunikation und unsere Infrastrukturen verfügt, verfügt letztlich auch über unsere Freiheit.
Wenn wir als Europäer selbstbestimmt leben wollen, müssen wir auch digital unabhängig werden. Es darf nicht länger sein, dass unsere digitale Zukunft in Washington entschieden wird. Europa muss den Mut finden, den Stecker selbst in der Hand zu behalten.