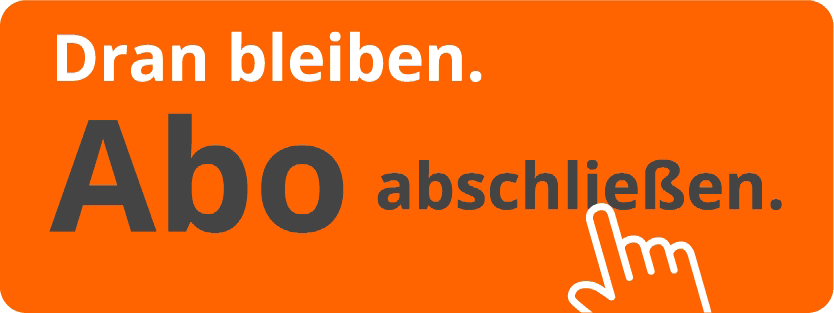„Die Natur hat ihre Pflichten bereits erfüllt“
25. August 2025
Was ist die Natur eigentlich? Eine gängige Definition lautet, sie sei der Teil der Welt, der nicht vom Menschen geschaffen wurde. Wobei der Mensch aber Teil der Natur ist. Schwierig. Und es stellt sich die Frage: Wie kann die Natur eine juristische Person sein und eigene Rechte haben? Ein Philosoph beschäftigt sich intensiv mit dieser Thematik.
Interview mit Dr. Matthias Kramm
ÖkologiePolitik: Herr Dr. Kramm, im Gegensatz zu einem Unternehmen ist die Natur gestaltlos, hat keine klaren Grenzen. Wie kann sie da eine juristische Person sein?
Dr. Matthias Kramm: Ich stimme Ihnen da völlig zu, eine Abgrenzung der Natur oder spezifischer Ökosysteme ist immer bis zu einem gewissen Grad eine menschliche Setzung. Handelt es sich um spezifische Ökosysteme wie einen Fluss oder einen Wald, so lässt sich eine Abgrenzung anhand der Frage, welche Komponenten notwendig für das Funktionieren dieses Ökosystems sind, zumindest gut eingrenzen. Aber etwas unscharf bleiben diese Grenzen dennoch. Der Begriff der Rechtspersönlichkeit kann diese unscharfen Grenzen allerdings in einem gewissen Maße verkraften. Eine Alternative wäre eine regionale oder nationale Eingrenzung, in der die Natur auf dem gesamten Territorium eines Bundeslandes oder eines Staates zur Rechtsperson würde. Hier wird noch einmal klarer, dass die Definition letztlich menschlich bleibt.
Im Gegensatz zu bisher bekannten juristischen Personen ist die Natur übergreifend. Wir sind Teil von ihr. Wie kann sie da ein Gegenüber sein?
Die Gegenüberstellung „Natur versus Mensch“ bzw. „Natur versus Kultur“ hat die westliche Welt stark geprägt. Die Rechte der Natur stellen diese Unterscheidung allerdings vielfach infrage, so z. B. bei den Māori in Neuseeland, welche Ökosysteme als Teil eines Beziehungsgeflechts verstehen, wovon Menschen selbstverständlich einen Teil ausmachen. Diese Einsicht finde ich wichtig, da es ansonsten passieren könnte, dass Rechte der Natur dazu missbraucht werden, lokale Bevölkerungen umzusiedeln. Auch ist es wichtig, menschliche Interaktion mit der Natur mitzudenken, um das Konzept der Rechtsperson auch für Kulturlandschaften in Betracht ziehen zu können.
Die Natur ist dynamisch, verändert sich unaufhörlich. Wer soll nach welchen Kriterien definieren dürfen, welcher Zustand erhaltenswert ist?
Rechte der Natur können verschiedene Rechte enthalten: z. B. ein Recht auf Existenz und natürliche Entwicklung, ein Recht auf Schutz, ein Recht auf Bewahrung und ein Recht auf Wiederherstellung. Gerade bei den letzten beiden stellt sich die Frage, auf welchen Zustand eine Bewahrung oder Wiederherstellung abzielen sollte. Sicherlich sollte man in dieser Frage vermeiden, sich auf einen romantisch definierten Urzustand zu beziehen. Kriterien könnten hier z. B. die Integrität eines Ökosystems sein, die erhalten werden sollte, oder seine Biodiversität. Ebenso sollte eine Romantisierung „unberührter“ Landschaften vermieden werden. Auch Kulturlandschaften, wie z. B. ein Kalkmagerrasen, können eine große Anzahl von Tier- und Pflanzenarten beherbergen.
Wenn die Natur Rechte hat, hat sie dann auch Pflichten?
Ich denke nicht. Auch wenn wir Rechte und Pflichten normalerweise zusammendenken, halte ich es für sinnvoll, diese Verbindung für die Rechte der Natur zu überdenken. Erstens ist die Natur nicht einer von vielen Partnern in einer Beziehung von Rechten und Pflichten mit dem Menschen, sondern sie bildet die Grundlage dieser Beziehungen und garantiert deren Bestand und Fortbestand über die Zeit hinweg. Zweitens sollte die Vertretung der Natur vor Gericht nicht zu neuen Formen der Bevormundung des Menschen gegenüber der Natur führen. Man kann aber auch argumentieren: Die Natur hat ihre Pflichten gegenüber den Menschen bereits erfüllt, allein dadurch, dass wir in und von der Natur leben, und es ist nun an uns, ihr etwas zurückzugeben.
Gibt es Beispiele für Rechtssysteme, in denen die Natur bereits Rechte hat?
Die beiden bekanntesten Fälle sind wohl die Verfassung von Ecuador, in welche die Rechte der Natur im Jahr 2008 aufgenommen wurden, und der Whanganui Fluss in Neuseeland, der im Jahr 2017 zur Rechtsperson erklärt wurde. Derzeit gibt es mehr als 450 Initiativen weltweit, welche auf verschiedene Weisen Rechte der Natur umsetzen wollen. Im September 2022 wurde das erste europäische Ökosystem, die spanische Salzwasserlagune Mar Menor zur Rechtsperson erklärt. In Deutschland gab es im letzten Jahr zwei Urteile des Landesgerichts Erfurt, in denen die Rechte der Natur als „schutzverstärkend“ anerkannt wurden. Dabei berief sich der zuständige Richter auf die EU-Grundrechtecharta.
Worin unterscheiden sich die Ansätze?
Zwischen den verschiedenen Modellen gibt es zahlreiche Unterschiede, z. B. ob spezifische Ökosysteme oder die Natur als Ganzes zur Rechtsperson erklärt wird. Darüber hinaus spielt auch die Frage eine Rolle, wer die Natur oder spezifische Ökosysteme repräsentieren darf. In einigen Modellen sind alle natürlichen und Rechtspersonen dazu berechtigt, in anderen Modellen gibt es eigens benannte Repräsentantinnen und Repräsentanten. Auch der Inhalt unterscheidet sich von Fall zu Fall erheblich, also welche Rechte eingeschlossen sind und welche nicht.
Was funktioniert bei diesen Ansätzen gut? Und was nicht?
Ein Risiko ist, dass die Gesetzestexte nicht angewandt werden. Daher ist es unbedingt nötig, die Zivilgesellschaft einzubinden und darüber zu informieren, dass Rechte der Natur bestehen und eingeklagt werden können. Ebenso braucht es eine aktive Einbindung von Richterinnen und Richtern. Insbesondere im Fall von Ecuador hat sich gezeigt, dass Letztere eine entscheidende Rolle spielen. Ein weiteres Risiko ist, dass Regierungen und andere mächtige Akteure die Rechte der Natur für ihre Interessen ge- und missbrauchen. Hier braucht es unbedingt eine Absicherung, dass in Gerichtsprozessen nicht am Ende diejenige Partei gewinnt, welche das meiste Geld in den Prozess stecken kann.
Was können wir daraus lernen? Was sollten wir in Deutschland anders machen?
In Deutschland bräuchte es sicherlich eine gute Abstimmung mit der bestehenden Gesetzeslage, u. a. dem Verbandsklagerecht. Ebenso denke ich, dass eine Einbindung der Zivilgesellschaft und von Richterinnen und Richtern entscheidend ist. Zu der Frage, ob man eine Verfassungsreform anzielen sollte oder lieber die Erklärung einzelner Ökosysteme zu Rechtspersonen – darüber scheiden sich die Geister. Gewissermaßen ergänzen sich beide Ansätze natürlich und können dazu beitragen, die benötigten politischen Mehrheiten zu mobilisieren. Ich bin mir allerdings gar nicht so sicher, ob es nicht mittelfristig sogar besser wäre, zunächst auf die kommunale Ebene zu schauen und eine Repräsentation der Natur z. B. auf der Ebene des Gemeinde- oder Stadtrates anzustreben. Das wäre innerhalb der bestehenden Gesetzeslage möglich und könnte für weitere gesetzliche Reformen den Boden bereiten.
Herr Dr. Kramm, herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
Buchtipp
 Matthias Kramm (Hrsg.)
Matthias Kramm (Hrsg.)
Rechte für Flüsse, Berge und Wälder
Eine neue Perspektive für den Naturschutz?
oekom, November 2023
112 Seiten, 20.00 Euro
978-3-98726-039-1
PDF kostenfrei downloadbar!
www.t1p.de/2x9w9