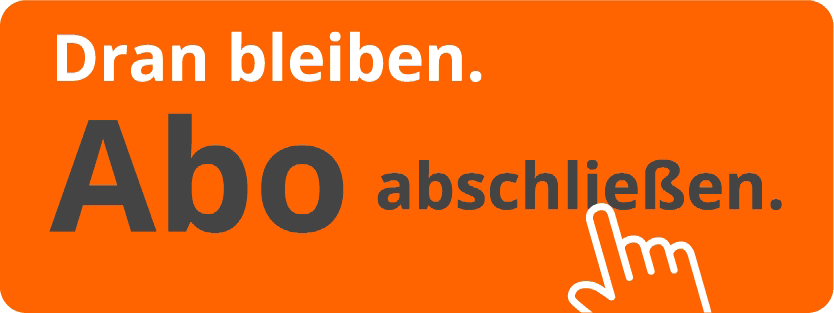Die Klimakonferenz in Belém
18. November 2025
Kurz vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, in Belém, konnte sich die EU gerade noch auf ein gemeinsames Klimaziel einigen: 90 % Emissionsminderung bis 2040. 5 % davon dürfen durch eingekaufte Verschmutzungsrechte aus dem Ausland abgedeckt werden. Zudem haben sich die EU-Umweltminister nach einem Vorschlag Frankreichs auf eine Revisionsklausel geeinigt, der zufolge das 90-%-Ziel weiter aufgeweicht werden darf, wenn natürliche Senken wie Wälder und Moore in den kommenden Jahren nicht so viel CO2 aufnehmen können wie eigentlich erwartet. Man einigte sich für 2035 auf ein Zwischenziel von 66–72 % weniger Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990. Das dient auch der Orientierung der anderen Staaten auf der Klimakonferenz.
Der EU-Emissionshandel bleibt umkämpft. Der neue Emissionshandel für alle Haushalte auf Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas (ETS2) soll jetzt erst ein Jahr später, also im Januar 2028, EU-weit an den Start gehen. Damit wird ausgerechnet das marktwirtschaftliche Leitinstrument geschwächt, mit dem kosteneffizienter Klimaschutz erreicht werden soll. Die EU-Kommission will 2027 mehr kostenlose Emissionsrechte ausgeben, die Förderung der Sanierung von Gebäuden ausweiten und die Anschaffung von Elektroautos fördern, auch wegen des Drucks von der deutschen Bundesregierung. Der EU-Klimazoll (CBAM) startet dann auch erst 2028.
Belém ist das Tor zum Amazonas-Regenwald. Die Goldschürferei vergiftet den Urwald und die Abholzung führt zu massiven Klimaveränderungen. Brasilien ist der fünftgrößte Umweltverschmutzer der Welt. Nur wenige Wochen vor Beginn der Konferenz wurde ein neues Gesetz zur Demontage des brasilianischen Umweltgenehmigungssystems verabschiedet. Es lockert die Beschränkungen für die Ölförderung und den Straßenbau im Amazonasgebiet. Ein Selbstgenehmigungsverfahren ermöglicht es Unternehmen jetzt in den Bereichen fossile Brennstoffe und Bauwesen, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Ausgleichsmaßnahmen zu umgehen. Unmittelbar nach der Gesetzesänderung begann Petrobras, das mehrheitlich staatliche Ölunternehmen des Landes, nur 200 Meilen von Belém entfernt mit Ölbohrungen. Die Lizenz dafür war zuvor aufgrund des Risikos eines weitreichenden Verlusts der Artenvielfalt in diesem empfindlichen Ökosystem im Falle einer Ölkatastrophe abgelehnt worden. Großbanken finanzieren die Öl- und Gasförderung im Amazonasgebiet. Im Juni 2025 versteigerte die brasilianische Regierung 172 Öl- und Gasgebiete, darunter umstrittene Flächen im Amazonasdelta.
Gastgeber Brasilien schlägt die Schaffung eines Regenwaldfonds (TFFF) vor, der die Entwaldung reduzieren soll, wodurch es sich zusätzliche Gelder erhofft. Dieser TFFF ist nicht Teil der offiziellen UNFCCC-Verhandlungen, sondern eine Initiative Brasiliens. Investitionen in fossile Energie sollen ausgeschlossen werden, ebenso wie Aktivitäten mit „erheblichen“ negativen Umweltauswirkungen. Diese Formulierungen bleiben jedoch vage, denn dieser Fonds basiert auf hohen Renditeerwartungen mit optimistischen Annahmen. Laut der Global Forest Coalition (GFC), ein internationales Bündnis von Umweltorganisationen, indigenen Gruppen und Basisinitiativen, droht der Fonds die Regenwälder zu reinen Finanzprodukten zu machen, bewertet nach Rendite statt nach ökologischen Zielen. Zudem werden indigene Völker nicht ausreichend eingebunden. Gerade Indigene verlieren durch die Zerstörung des Regenwalds ihr Land und ihre Lebensgrundlage. Studien zeigen, dass ihre Territorien und Schutzgebiete entscheidend für den Erhalt des Waldes sind. Dort wird besonders viel Kohlenstoff gespeichert und das Ökosystem stabilisiert.
Der Amazonas-Regenwald steht vor einem Kipppunkt, einer Schwelle, an der er so stark geschädigt ist, dass er sich dauerhaft in ein anderes Ökosystem verwandelt. Schon bei einer globalen Erwärmung um 1,5–2,0 Grad kann er seine ökologische Stabilität verlieren. Große Teile könnten zu trockenen Savannen werden. Aus einem globalen Kohlenstoffspeicher würde eine CO₂-Quelle. Bereits 2024 hat es im Amazonas-Regenwald so häufig gebrannt wie nie zuvor. Die Brände im Amazonasgebiet sind die Folge von Brandstiftung, illegaler Abholzung, Bergbau und Straßenbau.
Weltweit haben 2 Mrd. Menschen keinen Zugang zu sauberen Technologien und Brennstoffen zum Kochen. 673 Mio. Menschen leiden immer noch Hunger. Die Emissionen in Ländern des globalen Südens sind im Allgemeinen sehr niedrig. Im Juni stellte ein OECD-Bericht fest, dass die Mittel für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) der fast 40 OECD-Länder in diesem Jahr um 9–17 % unter den Vorjahresausgaben liegen, nachdem es bereits 2024 ein Minus von 9 % gegeben hatte.
Als Hotel für die hohen Gäste ankern Kreuzfahrtschiffe im Hafen. Es sollen 50.000 Gäste teilnehmen. Nur ein Drittel der Vertragsstaaten hat wie gefordert verschärfte Klimaschutzbeiträge (NDC) vorgelegt. Der Exekutivsekretär des UN-Rahmenübereinkommens zu Klimaänderungen, Simon Stiell, mahnt: „Nach einer zeitweiligen Überschreitung können und müssen wir die Temperaturen auf den 1,5-Grad-Pfad zurückbringen.“
Der bedrohlichste Aspekt des globalen Klimawandels liegt in der weitgehenden Irreversibilität der eingetretenen Veränderungen. Der zentrale Punkt bleibt der Ausstieg aus den fossilen Energiequellen. Zwischen den Konferenzteilnehmern gibt es tiefe Gegensätze. Die USA sind auf der Konferenz zwar nicht mehr dabei, aber US-Außenminister Rubio drohte bereits, diese Initiativen aus der UN-Bürokratie mit einer Koalition zu verhindern.
In einigen Regionen, insbesondere in China und Indien, wird weiterhin noch neue fossile Kapazität – vor allem Kohlekraftwerke – aufgebaut. Die globale Erwärmung wird bald das Pariser Ziel eines mehrjährigen Durchschnitts von 1,5 Grad überschreiten. 2024 wurde diese Grenze erstmals überschritten. Nach dem aktuellen Kipppunkte-Report gehen die höchsten Risiken von einem Zusammenbruch der atlantischen Meeresströmung (Erwärmung der Ozeane, AMOC, Golfstrom) aus. Das zweitgrößte Risiko ist die Entwaldung des Amazonas-Regenwaldes. Weitere globale Kipppunkte liegen im Schmelzen der Gletscher, der Permafrostböden und der polaren Eisberge.
Die Wechselwirkungen zwischen diesen Kipppunkten wirken ebenfalls destabilisierend. Das Kippen eines Systems kann das Kippen eines anderen Systems beschleunigen und wahrscheinlicher machen. Wenn der Klimawandel ungebremst weitergeht, kommt es zum Massensterben, zu Zwangsumsiedlungen und es sind schwere wirtschaftliche Verluste zu erwarten. Erneuerbare Energien sind stark im Preis gefallen und haben sich in ihrer Qualität sehr verbessert. Auch die positiven Entwicklungen werden sich gegenseitig verstärken.
Onlinetipps
Daniel Harrich
Verschollen – Schmutzige Geschäfte mit dem Klimaschutz
SWR Doku, 10.11.2025
www.t1p.de/htq5o
Germanwatch (Hrsg.)
Vom Verhandeln ins Handeln
Erwartungen an die COP30 in Belém
Hintergrundpapier, Oktober 2025
www.germanwatch.org/de/93283