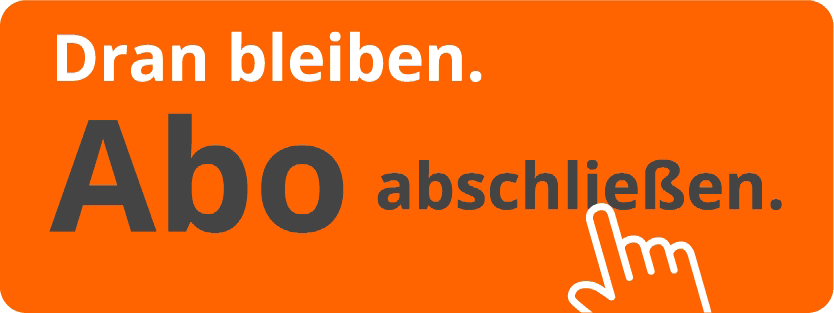Erinnern, Aufklären, Handeln
6. Juli 2025
Der Rechtsextremismus bleibt in Deutschland eine der drängendsten politischen Herausforderungen. Umso bedeutender ist die Eröffnung des NSU-Dokumentationszentrums in Chemnitz – ein wichtiger Meilenstein in der Aufarbeitung des NSU-Terrors.
von Thomas Löb
Das NSU-Dokumentationszentrum darf nicht isoliert bleiben. Die Initiatoren fordern eine nachhaltige Förderung durch eine bundesweite partizipative Stiftung, um die essenzielle Arbeit des Zentrums langfristig zu sichern. Denn trotz breiter politischer Unterstützung ist die Finanzierung über 2025 hinaus ungeklärt. Das Zentrum verkörpert die unerlässliche Notwendigkeit kontinuierlicher Bildungs- und Aufklärungsarbeit gegen rechtsextreme Gewalt. Es dokumentiert nicht nur die Verbrechen des NSU, sondern beleuchtet auch die gesellschaftlichen Mechanismen, die solche Taten ermöglichen.
Die Eröffnung sendet ein starkes Signal, doch um dem Rechtsextremismus effektiv entgegenzutreten, braucht es weit mehr als symbolische Meilensteine – es erfordert unermüdliches Engagement und entschlossene Maßnahmen. Der NSU-Fall hat nicht nur die brutale Realität rechtsextremer Gewalt offenbart, sondern auch tiefgreifende Defizite staatlicher Sicherheitsstrukturen und demokratischer Kontrollmechanismen. Diese Erkenntnis hat viele dazu bewegt, aktiv zu werden und sich politisch zu engagieren – denn die Bedrohung besteht weiterhin.
Immer mehr Jugendliche finden Rechtsextremismus cool
Die Notwendigkeit der Aufklärung über den NSU war nie größer als heute. Rechtsextreme Gruppierungen erstarken, besonders in Sachsen und Brandenburg, wo neue Terrorzellen unverhohlen Bezüge zum „Nationalsozialistischen Untergrund“ herstellen.
Gleichzeitig reift eine radikalisierte Jugendkultur heran, die von Hass, der Verherrlichung der nationalsozialistischen Ideologie und einer hohen Gewaltbereitschaft geprägt ist – ein Prozess, der durch digitale Propaganda, die sich im Internet wie ein Brandbeschleuniger entfaltet, zusätzlich verstärkt wird. Dies führt zu einem deutlichen Zugewinn an Mitgliedern und Wählern für die AfD und extreme rechte Parteien, sodass es unter Erstwählern mittlerweile cool ist, derartig zu wählen.
Solche Dokumentationszentren sollte es mehr geben
Vor diesem Hintergrund verdient das NSU-Dokumentationszentrum höchste Anerkennung. Ohne den unermüdlichen Einsatz der Überlebenden und Hinterbliebenen sowie antifaschistischer Initiativen wäre es niemals entstanden. Ihr Druck hat nicht nur Chemnitz bewegt, sondern auch die neue schwarz-rote Regierungskoalition dazu veranlasst, sich zu einem weiteren Zentrum in Nürnberg zu bekennen.
Doch die Vision muss größer sein: Ein Netzwerk solcher Dokumentationszentren in ganz Deutschland ist essenziell. Der Kampf gegen den Rechtsextremismus erfordert Entschlossenheit, Weitsicht und nachhaltiges Handeln!
Umgang der Behörden mit NSU-Terror war fahrlässig
Kurzer Rückblick: Von 2000 bis 2007 verübte der „Nationalsozialistische Untergrund“ – eine skrupellose rechtsextreme Terrororganisation, bestehend aus Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe – insgesamt 10 Morde, mehrere Bombenanschläge und zahlreiche Raubüberfälle. Bereits 1998 zogen sich die Täter in den Untergrund zurück, während wichtige Warnsignale über Monate und Jahre hinweg ungehört verhallten. Wie lange sollen NSU-Opfer und ihre Angehörigen noch unter dem Gewicht systematischer Ignoranz und institutioneller Versäumnisse leiden?
Der anschließende NSU-Prozess, der 2013 eröffnet und 2018 in einer lebenslangen Haftstrafe für Beate Zschäpe seinen Abschluss fand, legte nicht nur operative Fahrlässigkeiten offen, sondern auch eine tiefe institutionelle Krise innerhalb unserer Sicherheitsbehörden. Opfer wie Enver Şimşek und İsmail Yaşar, deren Schicksale für das unbeschreibliche Leid stehen, sahen sich gezwungen, im Jahr 2017 Schadensersatzklagen einzureichen, um die gravierenden Ermittlungsfehler sichtbar zu machen.
Kritiker, darunter Publizist Andreas Förster und CDU-Politiker Clemens Binninger, fragten zu Recht: War der NSU wirklich ausschließlich das Produkt eines Trios, oder zeigen unzureichend verfolgte Hinweise auf ein viel größeres, im Verborgenen agierendes Netzwerk? Solche unbequemen Fragen fordern ein entschlossenes Vorgehen gegen vertuschungsähnliche Strukturen.
In den vergangenen Jahren hat sich die düstere Realität rechtsextremer Netzwerke mit weitreichenden Verbindungen schmerzhaft manifestiert. Es ist unerträglich, dass gewaltverherrlichende Ideologien und deren Täter durch mangelhafte Ermittlungen verharmlost sowie durch systematische Nachlässigkeiten verborgen werden. Nur eine lückenlose und transparente Aufklärung kann – und muss – das öffentliche Vertrauen in unsere Sicherheitsorgane wiederherstellen.
Darum ist es höchste Zeit, dass sich nicht nur die Verantwortlichen in den Behörden, sondern auch die gesamte Gesellschaft die Frage stellt: Wie lange dürfen wir zulassen, dass fundamentale Versäumnisse den Rechtsstaat aushöhlen?
Mit Bildungs- und Aufklärungsarbeit entgegenwirken
Die ÖDP fordert eine grundlegende Reform, die über reine Kritik hinausgeht: Es bedarf verstärkter Bildungs- und Aufklärungsprogramme, die extremistische Ideologien von Beginn an bekämpfen, und einer gezielten Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements, um unsere demokratische Kultur nachhaltig zu stärken. Zudem sind die systematische Kontrolle und transparente Aufarbeitung aller sicherheitsrelevanten Strukturen unabdingbar. Warum müssen unschuldige Bürger weiterhin unter mangelnder demokratischer Kontrolle und Undurchsichtigkeit leiden, während gleichzeitig relevante Sicherheitsdokumente unter Verschleierung geführt werden?
Insbesondere zeigen jüngste Enthüllungen, dass Hunderte Akten – von Abhörprotokollen bis hin zu V-Mann-Meldungen – systematisch vernichtet wurden. Bereits im November 2011 wurden beispielsweise Akten zur sogenannten „Operation Rennsteig“ gelöscht, was strafrechtliche Ermittlungen wegen Strafvereitelung und Urkundenunterdrückung nach sich zog.
Diese vorsätzliche Vernichtung von Beweismaterial ist ein eindeutiges Signal dafür, dass nicht nur operationelle Fehlentscheidungen getroffen wurden, sondern auch, dass zentrale Informationen gezielt aus der öffentlichen Debatte verbannt werden sollten, um das Vertrauen in den Rechtsstaat nachhaltig zu beschädigen.
Als Landesvorstand der ÖDP Brandenburg verurteile ich aufs Schärfste den alarmierenden Anstieg rechtsextremer Vorfälle in Brandenburg! Insbesondere die an Schulen, wie zahlreiche Medienberichte belegen! Die jüngste Bundesschülerkonferenz warnt vor einer besorgniserregenden Zunahme rechter Hetze an deutschen Schulen und fordert dringend Reformen im Bildungswesen.
Hakenkreuze, Hitlergrüße und Hetzparolen – was nach längst vergangenen Zeiten klingt, ist für viele Schülerinnen und Schüler heute traurige Realität. Symbole und Parolen tauchen in Klassenzimmern, auf Schulhöfen und in digitalen Chatgruppen auf. Diese Entwicklung darf keinesfalls hingenommen werden.
Schule muss ein sicherer Ort sein – ein Ort der Aufklärung, des demokratischen Lernens und der aktiven Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart. Doch der Geschichtsunterricht allein reicht nicht mehr aus, um rechtsextremen Tendenzen wirksam entgegenzutreten. Es braucht mindestens einen verpflichtenden Besuch einer KZ-Gedenkstätte während der weiterführenden Schulzeit. Projekttage sollten genutzt werden, um aktuelle Entwicklungen zu diskutieren, während politische Bildung fächerübergreifend verankert wird.
Ebenso ist eine gezielte Weiterbildung der Lehrkräfte unabdingbar – insbesondere im Umgang mit extremistischen Ideologien und Radikalisierungstendenzen bei Jugendlichen. Um Extremismus frühzeitig zu erkennen und zu verhindern, muss die Schulsozialarbeit erheblich gestärkt werden. Mehr geschultes Personal ist nötig, um zuzuhören, hinzusehen und entschlossen einzugreifen.
Auch internationale Austauschprogramme und Partnerschaften müssen ausgebaut werden, um interkulturelle Begegnungen zu fördern. Darüber hinaus fordert die ÖDP Brandenburg verstärkte Bildungsprogramme, effektivere Kontrollmechanismen durch Sicherheitsbehörden sowie eine tiefgehende Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure.
Die strukturellen Mängel der Vergangenheit müssen dringend aufgearbeitet werden, um das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat zu festigen und unsere Demokratie nachhaltig zu stärken.
Onlinetipp
Offener Prozess
Ein Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex
www.offener-prozess.de